
Vorwort von Daniel Kuss
Bereits im Januar 2017 übersandte mir David Krüger Ablichtungen eines Tagebuchs, das ein aus Stralsund stammender Carl Klingenberg im Jahr 1914 anlegte. Auf 134 Seiten schrieb dieser handschriftlich seine Eindrücke, Gefühle und Gedanken als Mensch und deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg an der Ostfront nieder. Es liegt in der Natur der Sache von Kriegstagebüchern, schonungslos ehrliche Zeitzeugnisse zu sein.
101 Jahre später, im Sommer 2015, kaufte David das Tagebuch in einem kleinen Antiquariat im baden-württembergischen Heidelberg und digitalisierte es für die Nachwelt. Doch damit nicht genug. Er übersetzte das in Niederdeutsch, bzw. Plattdeutsch verfasste Werk und recherchierte zum Autor. Die einzige Nachkommin wurde ausfindig gemacht und sehr freundliche Kontakte geknüpft. So wissen wir dank akribischer Recherche in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Stralsund heute: der Autor heißt Friedrich August Carl Klingenberg, er wurde am 13. Oktober 1879 in Stralsund geboren, war der letzte Gürtlermeister in Stralsund, wo er am 15. Juli 1954 starb. David Krüger plant, das Original-Tagebuch an das Stadtarchiv Stralsund zu übergeben. Dort gibt es bereits Bestände zur Familie Klingenberg und im Stralsund Museum sogar einen Bestand zu Carl Klingenberg selbst. Mehr als nur eine tolle Geste. Ablichtungen des Tagebuchs können bei Dilibra kostenlos eingesehen werden.
Es ist so unglaublich wie auch schön, dass mehr als Hundert Jahre später Puzzleteile zusammengefügt und Geschichten, Namen und Gesichter belebt werden. Doch David Krüger gibt sich allein damit nicht zu Frieden, er recherchiert bereits zur Familiengeschichte des Autors, die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit, sehr wahrscheinlich bei David’s Heimatverein, dem Pommerschen Greif, veröffentlicht.
Die folgenden Aufzeichnungen dürften ganz gewiss nicht nur für Genealogen interessant sein. Der Text ist recht umfangreich, um die weiteren Kapitel zu lesen bitte einfach auf die jeweilige Überschrift klicken. Viel Spaß beim Lesen!
Wie der ganze Trödel anfing.
An einem schönen Sommerstag, als ich mit meinem lieben Freund Karl Schün von einem wunderschönen Ausflug nach Jacobsdorf, den wir mit dem Fuhrwerk seines Bruders unternahmen, zurückkam. In fröhlichster Stimmung fuhren wir in die alte Wasserstadt Stralsund ein und wunderten uns, warum dort alle Leute umherstürmten und die Köpfe hochsteckten. Och, meinten wir, da ist wohl wieder irgendwo in der Welt etwas passiert. Vielleicht ist wieder irgendwo ein kleiner Prinz geboren, das wurde ja schon immer gleich mit Extrablätter in der Welt herumposaunt. Den ganzen Tag lang erschien es uns so, als würden die Leute noch weiter herumirren. Es müsste also doch wohl etwas Anderes sein. War vielleicht ein großes Unglück passiert? Wir wurden nun doch neugierig und bekamen unterwegs so viel mit, dass es sich um ein Attentat handeln muss. Uns kamen alle mit ernsten Gesichter entgegen und hier erzählte man uns auch, dass der österreichische Thronfolger mit seiner Frau in Sarajewo auf der Straße umgebracht worden war.
Wie ein Blitz schlug uns diese Nachricht in den Magen: „Das gibt Krieg!“
Es wurde hin und her debattiert, was nun all daraus entstehen könne. Natürlich müsste der Serbe Strafe erhalten, oder würde der Russe leiden? Na, jedenfalls ging es uns ja direkt nichts an, die Österreicher würden schon mit den Serben fertig werden und der Russe würde auch wohl zugucken, wenn sie erst merken das wir unseren Bundesbruder nicht in Stich lassen würden. Wir ahnten noch nicht, dass der große Krieg doch ausbrechen würde. Nun folgten dann die langen, langen Wochen, wo aus der kleinen Ursache, die ja natürlich gar nicht mal die richtige Ursache war, sich eine große Wirkung entwickeln würde.
[read more=“Die Mobilmachung.“ less=“Die Mobilmachung.“]
In großer Unruhe verging die letzte Juliwoche. Ein Telegramm nach dem anderen kam an und wurde mit angehaltenem Atem überflogen. Wie wir doch inzwischen unsere friedliche Entwicklung missgönnten und mit Gewalt in den Krieg einstürmten. Der Kriegszustand war verhängt. Ich traf in unserem Rathaus meinen Onkel Beis, welcher auch ein richtiger Soldat ist, und sagte zu ihm im Vorbeigehen: „Na, Herr Major, nu geht’s los!“, „Aber das ist ja Unsinn“ redete er los. „Das ist ja Unsinn, die Leute sind ja alle wie verrückt geworden, Krieg! Krieg! Schreien sie alle“. Als mein Onkel aufschlagen will, sagte er: „Als wenn nun der Krieg schon losginge. Das ist alles nur Bluff! Die Erklärung des Kriegszustandes ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Ich versteh die Leute gar nicht, das rennt und rennt…“ Und damit wurde ich auch mal wieder unruhig, da auf dem Markt bei der Kommandantur weitere Zettel an geklemmt wurden, welche ich doch auch rasch lesen möchte. Am Freitag, den 31. Juli den nächsten Morgen waren alle still, bloß das Wort „Ultimatum“ ging von Mund zu Mund, alle warten auf Nachricht aus Russland. Einige Leute sagen um 12 kommt eine Antwort, andere sagen: „Na, erst heute Abend um sechs!“. Von Mittag an über fuhren alle mit Autos, als hätte man es noch nie gesehen. Manche überraschte dies. Wie ging es doch den Ladenjüngling bei Riedel. Er steht gemütlich hinterm Ladentisch und verkauft Glimmstängel, dann fuhr ein Auto vor, ein Kollege kommt rein und sagt zu ihm: „Hier lesen Sie, Sie müssen sofort abfahren zu Ihrem Truppenteil, dann und dann fährt Ihr Zug nach Kiel, steigen Sie sofort ein!“ „Aber mein Chef ist gar nicht hier, der ist heute auf Hiddensee“ „Ganz egal, halten Sie sich nicht auf, ich habe nicht länger Zeit!“ „Aber ich muss doch meinen Hut holen…“ „Hier setzen Sie meine Mütze auf“. Und damit stiegen sie alle bei dem Wickel dort mit ein und die Tür, ein nächstes Auto und los ging die Fahrt. Mein Freund, Kästing Diekermann, welcher grade dort stand, übernahm den Posten als Ladenswengel und hatte das auch gut gemacht. Sein Gesicht hätte ich auch gerne gesehen! Ja, ja, so wie hier, ist es wohl an diesen Tag noch anderen so ergangen. Selbstverständlich hatte ich auch so mal Unruhe, das ich es fast nicht aushalten kann. Ich muss unter Menschen, und wo trifft man wohl in erregte Zeiten mehr Menschen als im Krieg. Ich ging also zu dem Bruder. Dort war es ein Leben und mitten in dieses Leben kam ein Soldat eingestürmt und rief lauthals „Mobil! Mobil!“. Jeden Augenblick wurde alles still. Fast jeder hier wurde sich bewusst, was mit diesen lauten Worten gemeint war und wen das nicht bewusst war, da war doch so ein kleiner Happen lange Ungewissheit vor irgendetwas Großes schweres, was die Zukunft bringen soll. Bald schon kam wieder Lärm. Einige stimmten und schallten „Deutschland, Deutschland über alles“. Lange blieb ich hier nun auch nicht mehr, ich müsste nach Hause zu meiner Frau und müsste herumerzählen und ‘n herzlichen Schnack draus geben. Dann auch mit der Mobilmachung „am 3. Mobilmachungstag vormittags 9 Uhr“ stand auf einen Befehl. Na woraus meine Frau traurig wurde und wie ich ihr Trost gegeben habe, das geht keinen was an. Abends ging ich ins Leben und ging durch die Straßen und sah mir den Bahnhof an. Dort war ein Halten und Jagen überall. Bei den Wasseranlegestellen war es ein Gedränge mit Kutschen und Kasten. Hoch betagt führten die Droschken mit den Badegästen zum Bahnhof. Manche von den so meist kinderreichen Familien mussten sitzen bleiben, weil der Andrang so groß war. Spät am Abend noch gingen junge Menschen – so wie den ganzen Tag schon – durch die Straßen und sangen laut patriotische Lieder bis in die Nacht. Der Pastor und Superintendent H., bei dem seine Jungs als Offizier bei der Armee waren, führten vor der Kommandantur eine Rede und mit voller Begeisterung singen alle Menschen. Das war eine herrliche Viertelstunde. Nachts brachte auch nach den Oberst Hoch und Kaiser und den Gesang von Heil die im Siegerkrankt hatte sich den ganzen Tag in Bewegung und trug durch alle Straßen. Den anderen Tag war Sonntag und mittags auf dem Markt war eine große Wachtparade. Hierzu nahm ich meine Frau mit, da sie den Abend vorher nicht mitwollte, weil sie ja so traurig war. Wir stellten uns auf dem Balkon von Artushof und hörten uns die Musik mit an. Als erstes Stück brachte der Chor „Die feste Burg ist unser Gott“ mit vollen Orchester und Glockenbegleitung über den Markt. Es kam uns wie in der Oper vor, was ganz herzlich war. Bis hierher war nun alles ganz friedlich verlaufen. Nachmittags über kam Unruhe in die Stadt. Dort würde allerlei Gesindel unterwegs sein. Russische Spione würden von Boten in die Stadt gebracht werden. In der Stadt würden ebenfalls verdächtige Leute sein. Bei manchen stellte sich auch wirklich heraus, dass es russische Spione waren, wo welche, glaube ich, ungerecht verdächtigt worden sind. Jedenfalls war das eine Aufregung und mancher Russe wurde verdächtigt. Am Montag den 3. August, was ja der zweite Mobilmachungstag war, sah man manchen Bekannten in Uniform herumlaufen. Mittlerweise kamen auch alle Nachrichten über kleine Truppen an den Grenzen und unsere Ungeduld an den Feind zu kommen wurde immer größer. Das einzige was an diesen Tag ruhig ablief, mit welcher Ruhe und Besonnenheit die ganze Mobilmachung von Statten ging. Ich selbst musste am Dienstag den 4. August morgens 9 Uhr erscheinen. Auf dem Kasernenhof wurden wir erfasst und ich kam in die 7. Kompanie des Landes Infanterie Regiment Nr. 2 als Vizefeldwebel. Im Restaurant zum Brunnen würde das 2. Bataillon für unsere Kompanie entstehen. Ich wohnte zu Haus mit Von Rügen, Offizier Lieutenant, 3. Offizier, Lange, U.F. Klemann, Berge, Marker, Feldwebel Maestling, Oberstleutnant und Kompanieführer Meier von Saarpitz am Rhein. Am Sonnabend den 8. abends wurde bekannt, das unser Bataillon am anderen Morgen still verladen würden werde. Schleunigst machte ich noch zuvor Abschiedsbesuche. Am Sonntagmorgen, den 9. August um ¼ 10 führte der Tag aus Stralsund heraus.
[/read]
[read more=“Die Eisenbahnfahrt.“ less=“Die Eisenbahnfahrt.“]
Nun kam der Tag, wo wir die alte Heimatstadt, mit all das, war ich mir von klein auf an lieb und vertraut geworden ist, verließen. Ist dies nun das letzte Mal, das ich diese Stadt sehe? Ist dies nun ein Abschied für die Ewigkeit? Ist es möglich, das ich all das, war mir hier vertraut ist, nun für immer verlassen soll? Na, ich kann es nicht glauben! Na, ich glaube es nicht! Und wenn der Verstand mir tausend Mal sagt: „eine kleine Kugel muss dich bloß treffen, dann bist du tot“. Na, das letzte Mal ist noch nicht, ich werde die Stadt wiedersehen. Das mir so ein Gedanke, als das einzig schöne Stadtbild allmählich verschwindet. Mit einem tiefen Seufzer drehte ich mich vom Fenster ab, als ich nichts mehr von der Stadt sehen kann und setzte mich in eine Ecke. Im Abteil war wirklich Platz. Ich selber wurde an dem Tag dorthin kommandiert und habe mir selber natürlich keinen schlechten Platz reserviert. 2 Abteile teilte ich mir mit 4 Mann, welche für 3 Funktionsoffiziere und für mich bestimmt waren. In dem einem Abteil kamen die Drei und in das andere nahm ich noch den Unteroffizier der Reserve Mosler mit, da er ein kleiner, netter und verträglicher Mensch war. Zuerst saßen wir ruhig da, schon bald kam Leben in die Bude. Die, die nebenan waren, fingen an zu singen, und das steckt an. Das dauerte gar nicht lang, da sangen wir auch mit. Zuerst haben wir geglaubt, wir kämen nach Frankreich, da wir jedoch in Stralsund gegen Pocken geimpft worden waren, wussten wir alle, dass es nach Russland ging. Bloß das wir an die östliche Grenze kamen, das war uns noch verborgen. War es nun drinnen den Tag für alle etwas lebendiger geworden, so war es außen noch ganz anders. Die ganze Fahrt, so ging es 24 Stunden und es ging nach Thorn, war das ein Gewinke und Gejubel und Tuchschwenken nach uns. Kinder und alle Leute, Männer und Frauen winkten uns zu und sangen „Auf Wiedersehen!“. Aus jedem Haus, aus jedes Fenster wehten weiße Tücher und wünschten gute Fahrt und glückliche Heimkehr. Das ganze Reich war im wahren Triumphzug. Ob wir wohl einen Rückzug erleben? Womit an alle der große Wunsch liegt, ja. Da ist wohl keine Familie, in unser großes Vaterland, die nicht selber mehr oder weniger von dem Krieg betroffen wird. In allen größeren Bahnhöfen waren hervorragende Einrichtungen, um die tausenden von durchreisenden Truppen zu bewirten. Ganz besonders vorbildlich waren diese Vorkehrungen in Stettin. Da waren große, überdachte Hallen mit reichlich Tischen und Bänken aufgestellt, an die die Soldaten speisen würden. Hier gäbe es ein warmes Gericht. Ältere Damen und junge Mädchen verteilten außerdem noch Zigarren, Zigaretten, Butterbrot, erfrischende Getränke, etc. Alle mit freundlichen Gesichtern. Bei der Abfahrt winkten sie uns nach: „Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!“. Und so blieb es die ganze Fahrt, als wir durch irgendwelche Stationen kamen. Uns kamen Leute entgegen, den der Krieg nicht ersparte.
[/read]
[read more=“Tillitz bei Thorn. (10.-16. August 1914)“ less=“Tillitz bei Thorn. (10.-16. August 1914)“]
An dem Tag, den 10. August, kamen wir vormittags um 9 Uhr in der Festung Thorn an, wo wir auf dem Güterbahnhof entladen worden. Von hier aus traten wir unseren ersten, großen Marsch an. Das war an dem Tag eine ganz große Hitze und wir hatten unter das schwere Gepäck sehr zu leiden. Es dauerte auch gar nicht all so lang, dann machten 2 Kerle schlapp und blieben am Chausseegraben liegen. Die eigenen Stiefel waren noch nicht ordentlich eingelaufen, und nun gab es Blasen unter den Füßen. Ich bekam auch welche, aber ich selbst machte nicht schlapp. Der Marsch an und für sich war ja auch gar nicht weit. 12 km nach Tillitz. Wir sind ja später schon an einem Tag 4 Mal so weit gelaufen, ohne dass wir aufgeben mussten. Uns fehlte ja noch die Übung. Am 2. und 3. Tag blieben wir in Zakrzewsko zurück, und der erste Tag, bei dem ich war, kam in Tillitz in das Quartier. Tillitz selber ist ein großes Gut und führt ein polnischer Edelmann. Der Oberst Klemann und ich kamen ins Herrenhaus, die kleinen in die Schule. Ich habe eine kleine Stube mit Kabinett gehabt. Mein Fenster war ganz mit Weinlaub berankt, der Blick durch das Fenster fiel auf dem Teich, auf denen sich Enten und Schwäne tummelten. Hier in Tillitz, wo wir ja mehrere Tage blieben, hatte ich herrliche, friedliche Stunden verlebt. Meine Verpflegung, die ich von der Herrschaftsküche bekommen habe, war tadellos und wurde mir von dem Stubenmädchen in mein Zimmer serviert. In meiner freien Zeit, die sehr bemessen war, ging ich in den schönen Park spazieren oder setzte mich an dem Teich und beobachtete, wie das Federvieh sich dort amüsiert. Dort rauchte ich meinen Tabak und ging meinen Gedanken nach. Das war dort so still und friedlich, dass ich es mir mit Gewalt vorstellen musste, das ich in Kriegstagen war. Unser Dienst bestand hier mit kleinen Übungsmärschen und Gefechtsübungen in Bataillon und Regiment. Im Übrigen auch Exerzierdienst innerhalb der Kompanie. Wie lernten aus diesen Manöver die ganze Umgebung kennen. Eines Tages wurden wir alle in gelinde Aufregung versetzt, durch die Meldung, das feindliche Patrouillen, Kosaken in der Gegend gesehen worden sein. Wir hörten nachmittags auch heftigen Kanonendonner, welche sich als Übung bei Graudenz herausstellen soll. Jedenfalls mussten wir von nun an stets parat sein. Abends, wenn ich im Düstern die Butzenwache revidieren ließ, hatte ich das schönste Schauspiel. Die großen Scheinwerfer von Thorn und Graudenz schienen und Leuchtkugel stiegen auf. Jenes Tages sahen wir über der Festung auch einen großen Fesselballon aufstiegen und den ersten Flieger nach Russland einfliegen. Sonntag den 16. August rückten wir morgens zum Feldgottesdienst nach Ostaschewo oder Ostichau. Die Sache war durchaus nicht zierlich und der Marsch dorthin nicht wert. Ich bekam die Erlaubnis, nach Thorn zu reisen und habe mir die alte Stadt ordentlich angesehen. Herrgott, was war das für ein Leben in den Straßen. Alle Orte mit Militär vertreten. Ich glaube, da wäre nicht eine Gattung, die nicht vertreten wäre. Nachdem ich mir auf dem Markt in Artushof ein wenig sattgegessen habe, besuchte ich 2 Kirchen und sonstige Sehenswürdigkeiten. Die Stadt an und für sich konnte mir nichts besonders gefallen, denn sie ist nicht all so reinlich. Auch außen sieht es nicht schön aus. Meist bloß große Mietskasernen. Die große Weichselbrücke hatte mir mehr gefallen. Ich kaufte in der Stadt für meine beiden Kinder noch zwei Spielsachen, die ich zur Post nach Hause schicken ließ und ging abends nach Tillitz zurück.
[/read]
[read more=“Wolfserbe. (17. August 1914)“ less=“Wolfserbe. (17. August 1914)“]
Der schöne Tag von Tillitz hatte nun ein Ende bekommen. Heute Morgen mussten wir den gastlichen Ort verlassen und marschierten nach Gronowo, wie es auch seit einigen Jahren Wolfserbe heißt. Dies ist auch ein großes Gut und liegt ungefähr eine halbe Stunde von der russischen Grenze entfernt. Ein wunderschönes Schloss mit großen Turm steht mitten auf dem Hof. Hier würde nun der ganzen Sache alles gleich ein bisschen kriegsmäßiger angefasst werden. Verschiedene Wachen wurden aufgestellt. Ein Durchlassposten kam an die Chaussee, wo wir auch Hindernisse bauen mussten, damit Autos dort nicht so schnell durchfahren sollen. Wir nahmen dazu Wegsperren, die wir quer über die Chaussee stellten und fest verbunden hatten. Ein Aussichtsposten kam auf dem Turm. Hierzu drängten sich die Leute richtig, denn es stünde sich dort oben sehr schön. Man hatte eine ganz wunderschöne Aussicht über die ganze Umgebung. Am meisten Interessant war für uns natürlich die russische Siedlung. Das war ein wunderschöner Blick über das Tal der Drewenz. Hier fließt der Drewenz Fluss durch, welcher eine Zeitlang die Grenze bildete. Der Hintergrund war alles düsterblauer Wald. Sämtliche verfahrenen Besucher waren auf das heilige Zarenreich eingestimmt. Wir ahnten noch nicht, wie bald wir selber dort einrücken würden. Hier in Wolfserbe habe ich auch zum ersten Mal selbst Brot geschmiert. Ich habe eine schöne Scheibe Rindfleisch bekommen, kaufte mir ein bisschen Margarine, Butter war nämlich nicht zu kriegen, und machte mir ein Rumpsteak, welches ausgezeichnet geschmeckt hatte. Klemann hatte sich sein Stück in kleiner lauter Stücke geschnitten und dann gebraten. In Zukunft hatten wir uns dann immer zusammengefunden, er schleppte heran und ich kochte. Wir sind gute Kameraden geworden. Abends um 10 krochen wir in das Stroh und waren bis um 11 noch äußerst munter. Da wurden alle möglichen Witze erzählt und gelacht. Wir hatten ja die ganze Nacht zum Schlafen noch vor uns.
[/read]
[read more=“Das erste Menschenopfer.“ less=“Das erste Menschenopfer.“]
Prost Mahlzeit! Mit dem Ausschlafen war das nichts, denn früh um 1:30 wurden wir alarmiert. Schnell wurde noch ein wenig Kaffee gekocht und dann wurde abmarschiert zu den 5 Kilometer entfernt gelegenen Bahnhof Tauer, wo wir verladen werden sollen. Wohin es geht, wusste aber kein Mensch. Bald waren einige von uns Kerle beim Marschieren nicht mitgekommen. Als wir antreten sollen, fehlte einer. Gewehr und Tornister und Koppel war da, aber der Kerl selber war nirgendwo zu finden. Wir glaubten alle, er hätte sich schnell verdrückt, weil die Sache nun brenzlig wurde. Die Sachen kamen also zum Lazarett und wir rückten aus. Als wir an das letzte Haus ganz am Ausgang von dem Dorf vorbeikamen, kommt der Kerl in Unterwäsche heraus und starrt ganz verwundert auf unsere Marschkolonne. Es soll doch erst morgens um 6 angetreten werden, wie gestern Abend so gesagt wurde. Er hatte sich die ganze Nacht bei Marinka hingelegt, wo ihm das wohl besser, als in der Scheune gefallen hat. Na, unser Oberst war ja kein Unmensch und so beließ er es bei einer Verwarnung. Er wüsste ja als Landmann auch wohl, wie das auf dem Land manchmal ablief. Bei dem Verladen von Lebensmittel am Bahnhof Tauer passiert noch ein Unglück. Bei dem einen Lebensmittelwagen auf der schrägen Rampe kam einer ins Schwanken und der Fahrer fiel unter die Räder und schlug sich den Kopf auf. Das war das erste Menschenopfer, was der Krieg von uns gefordert hatte. Die Fahrt ging nun über Thorn – Nieszawa – Alexandrowo nach Wloclawek. Hier in diese ziemlich große Stadt verließen wir den Zug und marschierten über das fürchterliche Straßenpflaster durch den Ort und bekamen bei der Gelegenheit den ersten Einblick in russische Verhältnisse. Das Bahnhofgebäude könnte uns wohl gefallen, das war groß und schön eingerichtet. Schade drum, es soll nicht mehr lang stehen. Auch die Kirchen mit den großen, rund- vergoldenden Kuppeln machten einen hübschen Eindruck, allgemein machte die Stadt, mit Ausnahmen von wenigen Gebäuden, einen kümmerlichen Eindruck. Anständige, schöne Läden und Geschäfte, so wie es bei uns Zuhause ist, sieht man hier nicht. Als wir aus der Stadt herauskamen, mussten wir noch einige Kilometer nach Osten gehen und kamen schließlich, nachdem wir 1 ½ Stunden auf der Waldchaussee gegangen sind, nach Kowalewicz. Hier rückte unsere Kompanie auf Vorposten. Ich selber kam mit 24 Mann mitten in das schöne, hohe Kieferholz auf Feldwache. Hier waren wir nun alle 40 km in Russland drinnen und mussten hellwach auf dem Posten sein, dass uns keine Kosaken auf dem Pelz kommen. Na, das war unsere erste richtige Feldwache im Feindesland, und wir waren auch hellwach auf den Knien. Den anderen Morgen, den 19. August, rückte unsere Kompanie dann wieder nach Wloclawek ein, wo sich das ganze Detachement Reuter, so hat nämlich unser Oberst (er war ein Bruder von den Zabener), Infanterie, Artillerie und auch eine halbe Schwadron schwere Reiter sammeln ließ. Als wir noch alle dort standen, kam einer von unserem Flieger an, welcher bei uns gelandet ist und Meldung brachte. Nun würden wir einen beschwerlichen Marsch antreten, der uns zum Mittag nach Brzesc führen wird. Der Weg war meist tiefer Sand und ging meist durch Wald. Brzesc Kujawski ist eine kleine Stadt und noch mehr dreckiger als Wloclawek.
Je kleiner die Stadt, je größer der Dreck.
Wir kamen allesamt in Alarmquartiere, unsere Kompanie in die Zichorienfabrik. Da wir nun in Feindesland waren, wurde das, was wir notwendig für die Verpflegung brauchten, requiriert. Wir halten für die Kompanie ein schönes Kalb, welches wir auch bald schlachten würden. Die Leute mussten alleine abkochen. Ich hatte mit Feldwebel Maestling sofort die Leber bekommen. Wir gingen damit in ein Haus rein, wo wir eine Frau baten, uns diese zu braten. Sie war auch willig dazu. Sie saß dort mit 7 Kinder alleine, ihren Mann hatten die Russen weggeführt, um ihn in die Uniform zu stecken. Den ganzen Transport war über die Preußen gesungen worden. Sie saß mit großer Angst dort, denn die Leute hätten ihr gesagt, wir würden sie ja umbringen. Wir beruhigten sie natürlich und sagten ihr, dass ihr Mann bei uns besser aufgehoben wäre als bei den Russen, und das sie sich nach dem Krieg sicher wiedersehen. Wir aßen ein wenig und ließen ihr den ganzen Rest. Um die Kinder alle fröhlich zu bekommen, gaben wir noch jeder 2 Mark zu und gingen wieder. Sie hatte sich den preußischen Soldaten jedenfalls anders vorgestellt. Im Übrigen ließ sich das hier ganz gut leben. Es gab hier ganz gutes Bier. Brot und Fleisch sind hier nicht wenig. Für 1 Pfund bestes Rindfleisch bezahlt man hier ungefähr 30 Pfennig. Zum Anschein mussten wir uns außen vor der Stadt verschanzen, damit es so aussah, als wenn wir uns hier festsetzen wollen. Unser Detachement hätte überhaupt öfters so einen Auftrag gehabt, der bloß ein Bluff sein sollte. In der Nacht vom 20 auf den 21. Um 2 Uhr wurden wir alarmiert, das fast geräuschlos, und marschierten nach Wloclawek hin. Dort müsste wohl irgendwas in der Luft liegen. In Wloclawek waren alle verschiedenen Verhaftungen vorgenommen und auch unsere Truppe war von der Weichsel geschützt worden. Wir wurden wieder nach Deutschland verladen und hinter uns die Weichselbrücke in die Luft gesprengt und der Bahnhof angesteckt. In Alexandrowo fuhr ein Panzerzug. Der Bahnhof war alles durch das Flaggenkommando mit Landsturm besetzt. Wir fuhren über Thorn zurück nach Schönsee in Westpreußen. Wir marschierten durch die Stadt und kamen in Friederikenhof ins Quartier.
[/read]
[read more=“Friederikenhof – Birkeneck. (22./23. August 1914)“ less=“Friederikenhof – Birkeneck. (22./23. August 1914)“]
Hier in Friederikenhof hatte ich das schönste Quartier von dem ganzen Feldzug gehabt. Ich teilte mit dem Feldwebel Maestling ein schönes und gut möbliertes Zimmer im 1. Stock von dem Herrenhaus. Die Betten waren prachtvoll und die Verpflegung einfach großartig. Abends ging ich mit dem Feldwebel nach Schönsee, wo es vom Bataillon Büro Geld zum Sold geben soll. Hier traf ich auch Hermann Kleversaat. Wir hatten den Abend noch verschiedene Lokale aufgesucht und uns viel unterhalten. Als wir spät gegen 11 Uhr in unser Quartier kamen, war die Wirtschafterin und das Stubenmädchen noch auf und servierten und noch kalte und warme Speisen und entschuldigten sich, dass sie Kartoffeln nicht mehr erhitzen konnten. Sie hatten seit 8 Uhr auf uns gewartet.
Auf dem Tisch standen 2 stattliche Karaffen mit Rotwein, den wir mit dem größten Vergnügen uns zu Gemüt führten. In einem Schwung waren sie alle.
Den anderen Morgen hatten wir eine kleine Gefechtsübung auf dem Acker und waren gerade bei dem herrlichen Mittagessen, da kam folgende Meldung: „Um 3 Uhr steht die Kompanie bereit zum Quartierwechsel“. Oh, was waren wir wütend. All das fluchen hilft nicht, jeder Befehl ist heilig. Der Marsch ging zunächst nach Gajewo. Hier luden wir unsere Tornister ab und mussten dann wieder an die Drewenz marschieren. Hier standen wir nun wieder direkt an der Grenze. Die Gegend ging steil zu der Drewenz und war alles stark von uns befestigt. Wir selber mussten auch noch heran und die Gegend verschanzen. Die Gegend ist hier äußerst romantisch. Auf der anderen Flussseite liegt eine alte große Ruine mit Turm, das Ganze erinnert sehr an das Heidelberger Schloss. Jenseits von dem Fluss liegt das russische Gebiet der Stadt Dobrzyn. Durch das Fernglas konnte ich sehen, das auch dort das ganze Wehrgelände von uns mit Schützengräben, Zaun und Drahthindernissen befestigt war. Gegen Abend rückten wir wieder nach Gajewo aus und bekamen unterwegs im düsteren, auf dem Sandweg alle einen kleinen Vorgeschmack von das, was wir später noch in Russland erleben würden. Das Quartier im Herrenhaus von Gajewo war leidlich, die Verpflegung ging so. Am 23. Auguste morgens Abmarsch nach Schönsee und von dort aus mit der Bahn nach Strasburg an der Drewenz. In Schönsee war noch für die Abfahrt ein wenig Zeit übrig, Klemann und ich gingen noch zu einer Wirtschaft, wo wir uns rasch ein bisschen zurechtmachen würden. Dazu tranken wir eine Flache Portwein, die uns ordentlich aufgewärmt hat. Von Strasburg marschierten wir gleich wieder nach Birkeneck bei Hohenlinde. Die Gegend ist hier äußerst reizvoll. Schöne hohe bewaldete Hügel, im Grund einen schönen klaren See, umstanden von düsteren Tannen. Birkeneck selber ist ein großes Gut mit einem schönen Herrenhaus. Ich war dort auch wieder einquartiert und hatte eine schöne Stube und ein noch schöneres Bett. Hier wurde allerlei über Alarm gemunkelt, denn die Russen waren nur noch 25 km von uns aus entfernt. Na, diese Nacht habe ich doch noch recht schön und ruhig geschlafen. Das war nun auch für lange Zeit das letzte Mal.
[/read]
[read more=“Aus der Schlacht bei Tannenberg. (24. August 1914)“ less=“Aus der Schlacht bei Tannenberg. (24. August 1914)“]
24. August. Den anderen Morgen bekamen wir den Befehl zum Abmarsch, der uns dann auch gegen Mittag von Radfahrern überbracht wurde. Der Feind soll in Lautenberg sitzen, und wir sollen den dort herausschmeißen. Wir rückten also auf der Chaussee entlang und trafen allmählich die anderen Kompanien, die noch zu unserem Bataillon gehörten. Dann ging der Vormarsch los, immer an der Bahnstecke entlang, Bei den ersten Rendezvous wurde der Patronenwagen fertiggemacht und alle Leute bekamen noch lange Patronengürtel umgehängt. Der Major hatte sich wohl erheblich etwas vorgestellt. Wir hatten ja noch gar keine Patronen verschossen, hatten also noch jeweils 150 Stück pro Mann. Jedenfalls war das ein ganz großes Gewicht mehr zu schleppen. Wir klabasterten nun auf den Bahndamm entlang und gingen immer zu zweit entlang, einer über die Schwellen, grad so, als sie liegen würden. Gegen Abend kamen wir in einen Forst, hier mussten wir ganz leise marschieren, damit die Russen, die dicht bei uns sein sollen, uns nicht hören. Als wir an den jenseitigen Rand von dem Forst ankamen, hielten wir an. Jedes Sprechen wurde verboten, Licht durfte nicht angemacht werden. Der Major mit seinem Anhang war selbst noch am Ende gewesen und kam dann ganz geheimnisvoll an und sagte:
Alles bleibt lautlos, vor uns liegen die Russen und Kochen ab. Man kann die Feuer sehen. Wir werden sie nachher überfallen.
Na, das kann ja nett werden. Wir durften uns nun unsere Mäntel anstecken und uns mit dem Gewehr im Arm hinlegen. Mit einmal sahen wir vor uns allerhand Lichter auftauchen, die von Laternen stammen müssten. Es dauerte gar nicht lange, da hörten wir ein Knarren und Rattern. Als sie näherkamen, klangen sie gar nicht russisch, sondern verdammt deutsch. „Verdammter Lümmel, pass doch auf! Links rum! Halt! Halt! Der Wagen fährt wohl zu dicht auf!“, so schallte es muntern, wie ein Peitschenknall, durch die Nacht. Unsere ganze schöne Heimlichkeit war flöten gegangen. Unser Gepäck, das wir nicht auf dem Bahndamm mitnehmen konnten, hatte einen Umweg gemacht und kam uns nun entgegen. Nun würden ja die Russen munter werden und wegziehen. Schade, das aus unseren Überfall nun nichts mehr werden kann. Über die Russen, die unser Major gesehen hat, entpuppten sich nachher als unser anderes Bataillon. Was da wohl gesagt worden wäre, wenn wir sie im düsteren angegriffen hätten?
[/read]
[read more=“Wir wollen Wasser haben! (25. August 1914)“ less=“Wir wollen Wasser haben! (25. August 1914)“]
Bei Tagesanbruch ging der Vormarsch nun wieder weiter. Wir kamen bald an eine Waldchaussee und sahen hier die ersten Blutlachen. Unsere Radfahrer hatten hier alle feindlichen Kavalleriepatroullien getroffen und die ersten Schüsse ausgetauscht. Der Marsch war bei dem heutigen Wetter sehr anstrengend. Das Wasser in den Feldflaschen war über Nacht alle geworden, und die Leute haben unter großen Durst zu leiden. Wir kamen an verschiedene Gehöfte vorbei, die alle total verbrannt waren. Unterwegs trafen wir eine Sanitätskompanie. Das schien also wirklich ernst zu werden. Später wussten wir alle immer Bescheid, wann wir diese Brüder zu sehen bekamen; dann lag immer etwas in der Luft. Auf diesem Marsch kam es beinahe im Ort zu einer Meuterei. Weil gar keine Anstalt gemacht wurde, Wasser zu haben, fingen die Männer an, danach zu fordern. Schließlich musste der Kompanieführer nach vorne reiten und dem Major melden, dass alle Leute schlapp werden würden. Das hat dann auch gewirkt und er ließ bei dem nächsten Brunnen – sein Pferd – trinken. Wir marschierten vorbei. Na, hätten die Männer vorher nach Wasser gefragt, denn fingen sie nun an zu schreien und zu schimpfen. Bei dem nächsten Gehöft hielt der Major und hörte das. Die nörgelnde Kompanie blieb einfach stehen und schrie: „Wir wollen Wasser haben!“ „Wollt ihr vorwärts, marsch sage ich“, rief der Major. „Wasser her!“ sagen die Männer hinterher. „Wollt ihr das Maul halten“. „Wasser her!“ schallt es und die Kerle gingen nicht weiter. „Ich schieße den ersten besten von euch nieder, wenn Ihr nicht weitergeht!“ schrie der Major und sagte dann „Vorwärts, marsch!“. Na, es dauerte einen Augenblick, dann gingen die Männer langsam weiter. Wir Vorgesetzten mussten ja natürlich auch zustimmen, im Herzen geben wir aber doch den Männern recht. Sie hatten wirklich schwer zu leiden. Der Major musste allmählich doch einsehen, dass er von diesen Männern nicht die Hälfte von seinen Leuten mitbekommt und ließ nun Wasser holen. Das Kochgeschirr wurde aufgestellt und dann ging es zu dem Brunnen. Ach, wie schmeckt das Wasser schön!
Bald führte eine Artillerie an uns vorbei und es dauerte gar nicht lange, dann ging es Bumm, Bumm!
Als wir aus dem Wald herauskamen, mussten wir uns links von der Chaussee entwickeln und lagen nun ungeschickt dort ausgeschwärmt. Vor uns lag die kleine Stadt Lautenburg, wo unsere Artillerie die Feinde beschießt. Wir Infanteristen kamen zunächst nicht dazu, Schüsse abzugeben. Wir sammelten uns wieder auf der Chaussee und gingen geschlossen dicht an die Stadt heran. Unsere Kavalleriespitzen waren alle durch den Ort durch und haben keine Feinde mehr gesehen. Unser Bataillon bekam den Befehl durch den Ort zu gehen und jenseits Stellung zu nehmen. Wir rückten also mit vorgehender Spitze in die Stadt ein. Artillerie ebenfalls. Als wir auf dem Markt kamen, wurde das mit einem Mal eine Knallerei um uns herum, das hieß nichts Gutes. Aus der Kirche und den Kellern wurde auf uns geschossen. Unsere Männer waren ganz erstaunt und schossen auch gleich los, obgleich sie ja gar keine Feinde sehen konnten. Jeder Büchsenschuss hörte sich hier in den engen Straßen so an, als wenn eine Kanone losging. Das war eine Mordsschweinerei. Wir fingen dann nun an, die Häuser durchzusuchen. Durch die Türen brauchten wir gar nicht erst gehen, denn die Schaufenster waren alle schon zerschlagen und wir gingen durch das Glas. Zum Unglück fingen nun noch unsere Maschinengewehre von außen an die Dächer abzutragen, so dass es immer „tack, tack“ gegen die Häuser schlug und uns der Kalk und die Dachziegel um die Ohren flogen. Nun sitzen wir im Bedrängnis! Wir kommen nicht recht weiter und auch nicht zurück. Was sollen wir machen? Wir ließen also die Hornisten feste Blasen. „Das Ganze, halt!“ Endlich hörten dann die Maschinengewehre auf zu schießen und wir kamen dort wieder heraus, wo wir hereingekommen waren. Bei der nächsten Besichtigung fanden wir, dass unsere Verluste ganz gering waren. Wir gingen nun um die Stadt herum und gingen dort in Stellung, währen hinter uns nun andere Truppen in die Stadt zogen und das, was noch an Russen und verdächtigen Zivilisten dort war, festnehmen. Ein paar Zivilisten wurden noch denselben Tag erschossen. Da sich kein Feind mehr sehen ließ, bezogen wir vor der Stadt wache. Das war nun unser erstes Gefecht, und es war sehr zu bedauern, dass das so eine Schweinerei aus dem Hinterhalt geworden war. Einige von unseren Männern waren dadurch enttäuscht und haben erst allmählich in den späteren Gefechten das Gleichgewicht wiedergewonnen. Es hätte mit einer richtigen Feldschlacht anfangen müssen. Den nächsten Morgen machte ich der Stadt einen Besuch. Ach, wie sah es dort aus! Jammervoll. Ich will mich überhaupt nicht dabei aufhalten, das näher vorzustellen, das würde ich später schon noch tun.
[/read]
[read more=“Grausig sah hier die Gegend aus. (26./27. August 1914)“ less=“Grausig sah hier die Gegend aus. (26./27. August 1914)“]
Morgens ging nun unser Vormarsch nach Soldau weiter. 1 km von der Stadt fingen wir schon ans, uns zu entwickeln. Während meine Kompanie in das nächste Dorf einrückte und sich dort zuerst mit den Russen in der Wolle kriegte, blieb ich mit meinem Halbzug als Bedeckung bei unseren Maschinengewehren, die auf einen hohen Hügel in Stellung gingen. Wir lagen oben auf einem Berg in einer Mergelkuhle, wo wir gut gedeckt waren und auch einen schönen Ausblick hatten. Hinter uns war die schwere Artillerie aufgeführt. Wir können nun beobachten, wie sich jenseits von dem Dorf die Schlacht entwickeln würde und meldeten unsere Beobachtungen immer zu der Artillerie retour, die dann bei passender Gelegenheit zwei von ihren Kanonen rüberschicken würden. Wie brummt einen das über den Kopf, als wenn ein kleiner Zuckerschock durch die Luft fliegt. Ich glaube, wenn wir nicht in der Kuhle sitzen würden, hätten wir Blähungen in der Hose bekommen. Nicht vor Angst, nee, wegen dem Luftdruck. Auf einmal sahen wir dann die Dinger aufschlagen und große Fontänen von Dreck und Qualm aufstiegen. Da der Kampf immer wieder nach vorne ging, mussten unsere Maschinengewehre mehrmals Stellungswechsel vornehmen. Schließlich rückten sie in Galopp ganz auf und wir dann „hopp, hopp“, mit. Mein Befehl lautete mit meinen Leuten nun als Bedeckung bei der schweren Artillerie liegen zu bleiben. Das war immer ein unangenehmer Posten, denn die Artillerie lenkt immer die feindliche Schwester auf sich. Wir hatten dann auch bald Schrapnelle über uns und Granaten um uns, wurden glücklicherweise nicht getroffen. Dicht bei uns war eine Kompanie von L9 herangekommen. Dabei war ein Tambour, der hatte uns bespaßt. Ich lag nämlich mit meinen Leuten am Grabenrand von einem breiten Graben in großer Deckung. Das hat der Tambour gesehen und schlenkert sich vorsichtig an uns heran. Mit einmal fliegt etwas in die Luft und feindliche Schrapnelle platzen ganz dicht bei uns. Als das Knallen aufhörte, saß der Tambour auf dem Hintern, blass und mit einem Gesicht aus das die helle Angst sprach. Das war so komisch, so ein großer, vollbärtiger Kerl sich so jämmerlich benommen hatte, zu sehen. Dieses Theater wiederholte sich noch zweimal, und ich hatte noch zu sehen, dass ich diesen Kerl wieder nach seiner Kompanie hin gejagt bekomme. Mittlerweise war das Gefecht wieder fortgeschritten und auch die Artillerie zog weiter. Ich schloss mich nun an der Kompanie von L. 9 an und ging mit dieser weiter. Wir kamen schließlich durch Wald und an ein Gehöft, wo Munitionskolonnen standen. Etwa 1 km weiter war wieder das schwere Artillerie in Stellung. Wir blieben als Bedeckung hier liegen. Dann kam der Brigadestab bei uns vorbei und ich meldete mich bei dem General M. Dieser sagte: „Sie kommen mir gerade recht. Lautenburg hinter uns wird von feindlicher Kavallerie Abteilungen angegriffen. Wir müssen mit einem feindlichen Kavallerieangriff aus der Flanke rechnen. Sie nehmen mit Ihren Leuten dort jenseits der Chaussee Stellung und versichern auf jeden Fall, dass unsere Artillerie gefördert wird. Dort ist noch ein verschanzter Halbzug, der tritt mit seinem Führer unter Ihr Kommando“. So, das kann ja gemütlich werden. Nun hieß es aufpassen. Ich nahm also Stellung und beobachtete stetig durch das Fernglas. Ganz in der Ferne waren auch Abteilungen zu sehen. Da ich nicht erkennen konnte ob sie freundlich oder feindlich waren, blieben wir, damit sich vor uns auch keine Gefahr bildet. Als es langsam dunkel wurde und unsere Kolonnen angerückt waren, ging ich wieder zu dem Gehöft hin und schloss mich dort wieder der 12. Kompanie L 9 an. Als es nun komplett Dunkel war, mussten wir mit der Kompanie sofort antreten. Seitengewehr wurde aufgesetzt und ganz leise ging es nun vor. Richten taten wir uns nach vorher verabredete Lichtsignale, die wir mit unseren Taschenlampen gaben. Nachdem wir durch verschiedene Graben und Sumpfstrecken gegangen sind, hielten wir an. Hinter uns führte die Artillerie wieder ab. Ich tat Befehl mit meinem Halbzug, das Gepäck zu begleiten und wir kamen nachts um 12 Uhr bei dem Sammelplatz von der Artillerie an. Grausig sah hier die Gegend aus. Ganze Gehöfte standen in Brand, andere waren alle bis auf dem Grund abgebrannt. Verendetes und verbranntes Vieh lag überall neben den Trümmern. Über all diese Trümmer krochen wir herüber, um an die Wasserpumpe zu kommen, denn wir hatten alle großen Durst. Zum Zelte aufschlagen war keine Zeit, denn der Tag fing bald an und es ging ja dann wieder los. Wir wickelten uns also in unsere Mäntel und legten uns so auf dem Acker. Steif und kalt machten wir noch Kartenspiele und tanzten von dem einen Beim auf das andere, um wieder warme Füße zu kriegen. Bei Morgengrauen wurden wir von der Artillerie entladen und sahen bei Heinrichsdorf unsere Kompanie wieder.
27. August. Wir hatten uns gerade noch ein bisschen, warmen Kasten- und Kommissbrot geben lassen, da ging es auch wieder los. Nun waren wir eine Viertelstunde vormarschiert, dann kamen uns alle wieder eiserne Portionen zugeflogen. Vor und hinter uns, rechts und links, schlugen die Granaten ein. Wir überstehen mehrere Hügelketten und kamen auch durch kleine Waldstücke. Die Russen jagten wir immer vor uns her, von einer Stellung in die andere. Mehrmals gab es auch Pausen für uns, die wir jedoch immer eine halbe Stunde hatten, wo wir dann gerade in einem toten Winkel liegen blieben sind.
Wir waren mit anderen Truppen in Berührung, die Leute erzählten das in einem Wald 17 junge Mädchen liegen, welche die Kosaken die Brüste aufgeschnitten und den Unterleib aufgeschlitzt hatten.
Das soll ein grausiger Anblick gewesen sein. Welche davon hatten noch schwache Lebenszeichen gegeben und wir hatten dadurch eine grimmige Wut! Alle Gehöfte in der ganzen Umgebung standen mehr oder weniger in Brand, den ganzen Tag war das ein furchtbarer Anblick. Gegen Abend schwächte die Schlacht ab, bei Hohendorf machten wir zunächst halt. Vor uns lag ein tiefer, sumpfiger Grund, dort hatten wir die Russen durchgejagt, die nun die jenseitigen Höhen noch besetzt hielten. Weiter schafften wir nicht mehr, da wurde es lebendig. Erst kam ein Russe zum Vorschein und winkte mit einem Tuch. Ich ging mit 3 Mann auf einmal los winkte wieder, er soll mal kommen. Dann kamen immer mehr von solchen Männern zum Vorschein, um sich gefangen zu geben. Ich habe mit meinen Leuten an diesen Tag 1 Offizier und 66 Mann eingebracht. So etwas tat sich auch bei anderen Stellen ab. Einige von diesen Männern waren klatschnass. Sie hatten ganz und gar in den Graben gelegen und bloß den Kopf runtergehalten. Sie mussten sich ausstrecken und ihr Tuch auswringen, damit sie die Nacht nicht so stark frieren müssen. Einige waren auch mehr oder weniger schwer verwundet. Das war ein jämmerlicher Anblick, als wir sie in Briom durch das Dorf leiten mussten. In der Scheune wurden sie für diese Nacht eingesperrt. Wir bereiteten uns vor und machten Rast, also ohne Zelte, und kochten uns eiserne Portionen.
[/read]
[read more=“Ein wirklich schaurig, schönes Bild! (28. August 1914)“ less=“Ein wirklich schaurig, schönes Bild! (28. August 1914)“]
28. August. Diesen Tag vergesse ich in meinen Leben nicht. Bei Tagesanbruch fing das Getöse wieder an. Unser Bataillon kam für das erste nicht zur Entwicklung, sondern hatte den Auftrag als Unterstützung geschlossen hinter den nächsten Flügel zu folgen. Wir lagen den ganzen Vormittag in das heftigste Granatfeuer und mussten immer aufpassen, dass die Russen, die mit Streufeuer geschossen hatten, uns nicht treffen. Bald ging wir 30 Schritte links, dann wieder Rechts, bis es ein Ende war. Getroffen hatte uns nichts, obgleich viele Geschosse ganz dicht bei uns einschlugen. Bloß Dreck spritze uns um die Ohren. Einige von uns sahen wie die Schornsteinfeger aus. Schließlich lagen einige dicht bei zwei Strohballen, hier passierte folgendes: Unser Oberst R, der immer ein helles, ruhiges und überlegenes Ansehen hatte, stand bei uns. Wenn nun eine Granate angeflogen kam, dann duckten sich welche von uns Leute unwillkürlich und sofort. Na, der Oberst, der besser immer ganz am Ende hinter uns mitlief, läuft nun los. „Wer wird so feige sein. Das ist ja Schlappheit. Ich bitte die Herren Kompanie und Zugführer dafür zu sorgen, dass die Leute hier im Gefecht die Ruhe bewahren. Dieses Granatfeuer ist gerade ein guter Instruktionsstoff. Wenn die Granate trifft, den schlägt sie natürlich zu Gruß und Muuß, auch die zunächst stehenden. Wer da aber 10 Meter von ab bleibt, der wird höchstens mit Dreck beworfen. So ein Ding reißt doch höchsten einen Trichter von 3-4 Meter Durchmaß. Es ist schlapp, wenn die Leute sich davor ver…“ … Sch Sch Sch … – Bumm! Da kam wieder so ein Dreck angeflogen und Schwupp! Da saß plötzlich Herr Oberst mit einem ganz ängstlichen Gesicht hinter dem nächsten Strohballen. Wir können solche dämlichen Leute hier auch Strohballen hinstellen. Na, jedenfalls hatte diese Instruktion doch eher große Früchte getragen, und wenn im späteren Verlauf des Feldzuges der Oberst wieder so bombastisch geworden ist, dann wussten wir immer, was wir daran zu halten hatten. Bald nachdem dies passiert war, wurden wir von einer Herde Kühe attackiert. Die Russen hatten die Armen Biester wohl für Kavallerie angesehen und feste mit Schrapnellen versehen. Die Tiere hatten grässliche Wunden und bluteten stark. Wir waren noch so schüchtern, dass wir sie weggejagt haben. Nachmittags, als die Schlacht wieder ein bisschen ruhiger geworden war, mussten wir auch wieder vor und sollen Niederhof zunächst erreichen. Auf dem Weg dorthin kamen wir über ein großes, freies Feld, welches mit Waldstücken umgeben war. Das Bataillon ging in Marschkolonne, die nächste Kompanie mit ca. 30 Schritt Abstand. Uns kam das ein bisschen unheimlich vor, so geschlossen auf diesen Präsentierteller weiter zu gehen und ich tauschte diese Bedenken auch noch mit Klemann aus. Unser Bataillonsführer meinte wohl, das hätte nichts zu sagen, weil wir ja rundum gegen Sicht ordentlich gedeckt waren. Er hatte seine Rechnung ohne die russischen Spione gemacht. Mit einem Mal fing es rechts von uns an zu schießen und es kamen russische Schrapnelle auf uns zu. Bäug! Ratsch! Platzen die Dinger etwa 50 Meter rechts von unseren Kolonnen. Als wenn der Blitz einschlug, so hatte uns dieses überrascht und in allen Richtungen strömte das ganze Bataillon umher. Bum, bum, bum, bum! Ging das wieder und eine Ladung platzte jetzt gerade über uns.
Ich bekam eine Kugel oder ein Sprengstück gegen meinen rechten Fuß. Das war ein brennender Schmerz! „Der Fuß ist weg“, dachte ich.
Ich bekam zu sehen, wie das Blut umherspritzte. Das Blut wurde weniger. Ich stellte fest, dass das gar nicht durchgeschlagen war. Bloß eine kleine Beule war in meinem Fuß. Ich stieg also schnell auf und versuchte, ob ich noch laufen kann. Wahrhaftig, das ging noch! Na dann bin ich losgelaufen. Noch zweimal schickt uns der Russe solche Grüße herüber, und jedes Mal, wenn sie die Dinger platzen ließen, duckten wir uns, und das Feld sah aus, als wenn es mit Tote besäht war. Ach Gott, wir kriechen sofort unter die Tornister. Den Kopf ganz eingehalten und die Beine dicht aneinander. Sobald das Prasseln von den Kugeln und Sprengstücken neben uns vorbei war, dann kam Leben in die ganze Gesellschaft und alles geht weiter. Was kommt man sich in so einem Moment dämlich vor! Na, was soll ich sagen, das ganze Bataillon war vorläufig von der Bildfläche verschwunden. Was war der wirkliche Erfolg für die Russen? 1 Mann von uns Tot und ungefähr 30-40 Mann meist leicht verwundet. Die meisten Schrapnellkugeln waren in den Tornistern stecken geblieben. Wir hatten alle sofort die Empfindung, als wenn eine unsichtbare Hand uns geschützt hat. In Niederhof fand sich das Bataillon zum großen Teil wieder zusammen. Als wir in der Dorfstraße uns gesammelt haben, fliegt noch ein Schrapnell dicht über uns vorbei. Wir gingen auch noch in Stellung und sammelten uns dann in der Richtung auf der Chaussee nach Soldau. Hier hatten wir noch eine halbe Stunde Rast, um die Roste von dem Bataillon noch aufzunehmen. Währenddessen zog ich meinen Stiefel aus, um mir meinen Fuß näher anzuschauen. Ach, wie sah das aus. Der kleine Zeh war dick angeschwollen und sah wie eine dicke Pflaume aus. Die anderen Zehen waren auch Blau geworden. Diesen Abend musste ich noch stark humpeln. Den folgenden Tag über ging der Schmerz allmählich ganz weg. Nachdem sich nun dann auch die meisten Leute wieder angefunden hatten, rückte das Bataillon auf der Chaussee nach Soldau vor. Rechts und links in den Chausseegraben lagen Tote und Verwundete, meist Russen. Als wir alle im Düstern an den ersten Häusern von der Stadt vorbeikamen, mussten wir links von der Chaussee auf dem Acker ohne Zelte ein Lager aufschlagen. Das Bild, was hier unsere Augen sahen, war einzig. Grausig schön! Die Stadt Soldau stand in hellen Flammen. Haushoch schlugen die Feuersäulen aus den Dächern heraus. Der Kirchturm hatte all sein Dach verloren und sah nun wie eine große, brennende Fackel aus. Und vor diesen Hintergrund zogen nun andere von unseren Truppen als Silhouetten vorbei. Marschierende Infanteriekolonnen, Artillerie und schwere Landwehrreiter mit den großen Stahlhelmen und Lanzen. Nach unserer Sicht waren sie alle schwarz wie Schattenbilder, sie waren bloß von dem Feuer noch beleuchtet. Ein wirklich schaurig, schönes Bild! Zu essen hatten wir nichts bei uns, nur ein kleines Stück trockenes Kommissbrot. Zu trinken bloß nur noch ein kleiner Schluck Wasser in der Feldflasche. Wir schliefen trotzdem dort auf dem Acker.
[/read]
[read more=“Nach der Schlacht. (29. August 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (29. August 1914)“]
Den anderen Morgen wurde uns bekannt gemacht, das wir hier bei Soldau zwei Tage Ruhe haben sollen. Unser Regiment soll hier als Hauptreserve liegen bleiben, und gleichzeitig Tote von dem Schlachtfeld säubern. Wir schlugen nun also Zelte auf und fingen an, uns häuslich einzurichten. Ich musste mich nach Schlachtvieh für unsere Kompanie umsehen und requirierte einen schönen Bullen. 3 ½ Jahre später hatte ich diesen wieder in Händen. Er wurde uns von der Behörde zur Begutachtung übersandt, da der Bulle schwerer war, als er auf dem Zettel stand. Er wurde dann gleich von unserem Zahlmeister gegen Geld eingetauscht. Im Übrigen war an diesem Tag kein Dienst, wir hatten noch Zeit, um uns das Schlachtfeld näher anzuschauen. Die Gegend ist hier sehr hügelig. Stellenweise sind die Hügel so hoch, dass man sie beinahe als kleine Berge ansehen kann. Ab und an traf man auf kleine Waldparzellen. Welche dieser Gehöfte und Dörfer sorgten dafür, dass das Gelände noch unübersichtlicher wurde. Die Russen haben sich dies sehr zu Nutzen gemacht und alle Hügel mehrfach mit Schützengraben befestigt. In Anlegen von solchen Gräben ist der Russe wirklich ein Meister. Wir haben auch im späteren Verlauf des Feldzuges noch oft Gelegenheit gehabt, ihr Machtwerk zu bewundern. Fein sauber aufgetragen, waren ihre Gräben und Unterstände, bombensichere Deckungen und Beobachtungsständen, angelegt. Das Ganze, weite Feld war mit einem Netz von Telefondrähten überspannt. In Häuser, in Gräben, auf Bäumen, selbst in den Wasserdurchlässen unter der Chaussee saßen ihre Beobachter. All das hatte ihnen nichts genützt, wir haben sie schnell dort wegbekommen. Das ganze Feld war mit russischen Waffen und Montierungsstücken übersäht. Alles haben die Kerle weggeschmissen. Rucksäcke, Mäntel, Kochgeschirr, Brotbeutel, Gewehre, Säbel, Munition. Alls was sie hatten, lag dort herum. Wir suchten uns dort aus, was wir gebrauchten konnten und manches Andenken wurde mitgenommen. Der Erfolg war uns ungeheuer. Das ganze große Gepäck von der russischen Armee haben wir genommen und im Ganzen hier bei Tannenberg über 90.000 Gefangene gemacht. Von nun an haben die meisten Kompanien bei uns russische Feldküchen. Im Laufe des Tages musste ich auch noch in die Stadt herein, um verschiedene Kleinigkeiten für die Kompanie zu besorgen. Oh, was war das für ein trostloses Bild, was sich mir dort geboten hat. Die meisten Häuser an den Hauptstraßen und auf dem Markt waren ausgebrannt, einige große Häuser brannten noch lichterloh und steckten andere noch an. Zum Löschen war kein Mensch dar. In der Stadt sah man bloß hier und da zwei von unseren Soldaten. Sämtliche Schaufenster waren eingeschlagen. Alle Flaschen und Gläser in den Hotels und Restaurants kurz und klein geschlagen. In den Kaufmannsläden war alles ausgeraubt und die Ware über den ganzen Fußboden zerstreut. In den Tuchläden die Stoffe ausgeraubt und zerfetzt. Ganze Kleidergestelle lagen auf dem Boden. Alles war verlassen, kein Zivilist zu sehen. Jetzt waren unsere Leute dabei, sich aus diesen Müll noch irgendetwas brauchbares herauszusuchen. Welch schöne, teure Kleiderstoffe wurden nun für Fußlatschen verwendet. Ich fand als einzig brauchbares in einem Eisenladen noch zwei Schlachtmesser. Das war das einzige, was ich aus der Stadt mitgenommen habe.
Was ich dort noch in einigen Wohnungen und in den Flurdielen gesehen habe… dort lagen Greise, Frauen und Kinder in einem Zustand, von den ich lieber schweigen will. Gott bewahre uns bloß vor der Kosakenbande.
Ich war froh, als ich aus der Stadt, über die noch Qualm und Brandgeruch lag, herauskam. Den nächsten Tag, der 30. August war ein Sonntag. Ich habe mir vorgenommen nun einen Brief nach Hause zu schreiben, kam doch nicht dazu, da ich den Auftrag bekam, mit meinen Leuten nach der Schlacht das Feld nach Leichen und Kadavern abzusuchen. An einem hohen Bahndamm hatten wir auch noch 10 Russen liegen, die nach ihrer Stellung und Lage zu urteilen, wohl alle sofort das Opfer von ein und dieselben Granate sein müssen. Ich ließ nun eine große Kuhle graben, in der wir die Toten reinpackten. Wie grässlich sahen doch welche von den Leuten aus. Einige ganz blaurot angelaufen, andere Gelb wie der Wachs. Vorsichtig wurden sie auf eine Zeltbahn gelegt und dann vorsichtig in die Grube gelassen. Zum Teil waren sie alle in Verwesung übergegangen. Ein ekelhafter Geruch ging uns durch die Nase. Uns wurde ganz übel. Als die Kuhle zugeschüttet wurde, setzten wir ein einfaches Holzkreuz, dass wir aus Latten zusammengenagelt haben, auf dem Hügel. Ich schrieb dort auf: „Hier ruhen 10 Russen“. Nachdem sich die Leute bei einer nahen Pumpe gewaschen haben, ließ ich antreten und stillstehen und hielt eine kleine Ansprache, um dieses traurige Geschichte, was wir hier machen mussten, doch wenigstens ein kleines bisschen anmutig zu machen. In ernsten Gedanken gingen wir zu unserem Feldlager zurück. Zum Briefschreiben war mir die Lust vergangen. Aber was nützt das alles, die Gegenwart verlangte ihr Recht. Mittags müsste nun doch weitergedacht werden. Heute hatte unsere Kompanie ein Schwein geschlachtet und nun versucht jeder es so gut wie es ging, sich das schmackhaft zu bereiten. Ich hatte also das Fleisch mit Kochgeschirr ins Wasser getan und ließ es kochen. Klemann musste mir eine große Rübe und Kartoffeln holen und letztere auch schälen. Ich nahm die Rübe und schnitt sie in feine Streifen, so wie ich das früher auch Zuhause gesehen hatte. Als das Fleisch eine Stunde gekocht hatte, tat ich Kartoffeln und Rüben mit in den Pott und ließ das Ganze noch eine gute halbe Stunde kochen. Salz und auch ein bisschen Zucker hatte ich hinzugegeben und nun wurde das fein abgeschmeckt. Uns hatte das Essen ausgezeichnet geschmeckt und Klemann meint, so soll es seine Frau später auch kochen. Wir hatten unser Essen kaum im Magen, so wurden wir alarmiert und rückten in die Richtung aus Neidenburg ab. Gegen Abend rückten wir zwei Kilometer vor Neidenburg von der Chaussee ab und marschierten nun zwei Stunden im düsteren über Feldwege und Acker. Wir kamen an ein Dorf, wo wir uns, wie auf dem Acker, hingelegt haben. Ich hatte Magenschlag bekommen und musste oft austreten. Ich wurde das ganze Essen wieder los. Ich hatte mir wohl den Magen verdorben. Für diesen Fall hatte ich mir von Zuhause Medikamente mitgenommen. Ich tat mir also im düsteren davon etwas auf ein Stück Zucker. Mir hatte dies gut geholfen, den anderen Tag wurde es mit mir besser. Frühmorgens um 3:15 Uhr traten wir wieder an und umgingen eine russische Stellung. Eine versprengte Abteilung von diesen Brüdern hatte sich hier bei Niederau in ein langes, mooriges Tal festgesetzt. Morgens um 4 Uhr kamen wir in unsere Stellung und rückten sie mit Artillerie und Infanterie vor uns. Nach 2-3 Stunden war das Gefecht vorbei und wir marschierten zu unserem Feldlager bei Soldau zurück, wo wir spät abends Hundemüde ankamen.
[/read]
[read more=“Feldlager bei Soldau (1./2. September 1914)“ less=“Feldlager bei Soldau (1./2. September 1914)“]
Die beiden nächsten Tage, den ersten und den zweiten September, waren zur Ruhe bestimmt. Die Truppen sollen sich nach all den letzten, anstrengenden Tagen, erholen. Nun entwickelte sich ein gemütliches Leben im Feldlager. Es wurden 3 lange Zelte für die 3 Züge aufgebaut. Ein Zelt für den Oberleutnant und Leutnant und noch ein Zelt extra für uns 4 Feldwebel und die Funktionsunteroffiziere. Hierzu kamen dann noch die beiden Kompanieschreiber. Mit dieser ganzen Gesellschaft müssen wir uns hier erst ein bisschen näher befassen, dann für die nächsten Wochen schlossen sich alle diese lieben Leute zusammen und bildeten gewissermaßen eine Familie. Kurz zusammen gefasst nannten wir diese Gesamtheit den „Stab der Kompanie“. Dort ist nun zuerst der Oberstleutnant M., unser Kompanieführer. Er war von Natur aus ein Landmann und hatte auf Rügen ein großes Gut gepachtet. In dienstlicher Besetzung darf ich ja alle von wegen der richtigen Subordination kein Urteil über einen fällen. Er hatte stets den besten Willen und ließ sich, da er ein bisschen einen Ortsinnmangel hatte, gerne unter die Arme greifen. Waren wir auf einem Marsch, dann war er meist mit weg von seiner Kompanie und ein Zugführer, welcher gerade da war, erledigte seine Geschäfte. Wir hatten über öfters mal keinen Befehl, dann sagte er meist: “ Bitte die Herren Zugführer, veranlassen Sie das“. Kamen wir in ein Quartier, dann hatten sie alle einen solchen Drang, dass es ein bisschen warmes Essen gab. Über dienstliche Sachen und Dinger die an einem Tag passiert waren, redete er bloß, wenn wir einen Vorzug errungen haben. Und auch dann noch ungerne. Das schönste Schnitzel war ihm lieber. Als Anwärter für den Offiziersrang bei der Kompanie war Leutnant L. da. Er war ein sehr freundlicher und ruhiger Mann, der seine Dinge verstanden hatte. Er kommt überhaupt nicht als Familienmitglied in Betracht, denn er wurde bald Regimentsadjutant. Ebenso musste Vizefeldwebel M. ausscheiden, der bei Heinrichsdorf verwundet wurde und vorläufig nicht wiedergekommen ist. Vizefeldwebel Kl. war ein Rektor aus der kleinen, vorpommerschen Stadt G. Er war ein sehr ruhiger, freundlicher und stiller Mann. Bloß in wirtschaftlichen Sachen war er ein bisschen unbeholfen und verkramt öfters seine Sachen, die er meist noch in der Hand hatte. Er war ein prächtiger Kerl mit großen Gemüt und verlor auch im stärksten Gefecht nicht seine Ruhe. Vizefeldwebel B. war noch bedeutend jünger als wir. Er war Student der Philosophischen Fakultät und mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen. Er war namentlich in der ersten Zeit ein bisschen übersinnig. Blinder Eifer schadet nur. So hätte er sich selber damit öfters geärgert, wenn er nicht die richtige Anerkennung bekam. Er war aber auch ein mutiger Kerl und ein guter Kamerad. Als Dritter Zugführer kam ich nun selber. Wie ich von Natur aus beschaffen bin, werden wohl die merken, die dieses geschriebene lesen. Ich war meist derjenige, der auch in trüben Stunden, durch irgendeinen trockenen Witz für die richtige Stimmung gesorgt hatte. Dienstlich hatte ich niemals einen Tadel bekommen und bin mit meinen Vorgesetzten und Leuten immer gut fertig geworden. Der etatmäßige Feldwebel Maestling war ein kleiner, untersetzter Mann, so ein richtiger Dreikäsehoch. Er war 12 Jahre Unteroffizier und hatte 1 ½ Jahre die Kantine in G. gepachtet. Der Krieg war im gerade recht gekommen, da er zu dem Zeitpunkt gerade keine Beschäftigung hatte. Er war in den Verkehr mit den Leuten sehr drastisch, hatte immer ein gutes Herz. Er hing sehr am Leben, war immer stets pessimistisch. Er fiel später in dasselbe Gefecht, in welches ich verwundet wurde. Nun kamen die drei Funktionsunteroffiziere. Dort war zunächst Sergeant Schultz, er war ein Zivilbäcker und Müller. Er war die verkörperte Ruhe. Er wies uns Kammerunteroffiziere und führte den Packwagen. Bei der Einkleidung noch in Stralsund stand er bloß dabei und kuckte zu, wie wir Feldwebel unsere Sachen vergessen taten. Im Feld sorge er dafür, dass die Kompaniekiste und unsere Kleiderstücke richtig verstaut wurden und dass wir abends alle eine große Schlafdecke kriegen. Außerdem hatte er manchmal eine kleine Flasche in seinem Packwagen. Er konnte wunderschön mit Ausdauer schlagen und damit seine Leidenschaft ausleben. Außerdem sorgte er dafür, dass sich, wenn wir irgendwo im Quartier lagen, das Fensteraufmachen des Morgens auch lohnen ließ. Schießunteroffizier war Franke, ein Schlachtermeister aus Essen an der Ruhr. Er führte den Patronenwagen. Er hatte die Oberaufsicht beim Schlachten und war dabei ein schneller Mensch, der sein Handwerk verstand. Er sorgte dafür, dass die besten Stücke für den Stab reserviert würden und schmorrte und bratete für uns. Seine Saucen wurden direkt berühmt. Der Mann war stets gefällig. Den wichtigen Verpflegungsposten hatte der Unteroffizier Wessel, ein Dorfschulmeister aus der Anklamer Gegend. Er war für diesen Posten eigentlich zu anständig. In der ersten Zeit hatte er mal Ärger gehabt, denn sie bemeierten ihn oft ein bisschen Empfangen von Lebensmittel. Er sprach immer so sachte und bedächtig mit den Leuten. Hatte sich bald in sein schweres Amt eingearbeitet. Stets sorgte er gut für die Leute und insbesondere für den Stab. Oftmals kam er ganz geheimnisvoll an und steckte uns irgendetwas Gutes zu. Nun kamen noch die beiden Kompanieschreiber. Der eine war Salzbrenner, ein Produkthändler aus Stockholm. Er besorgte in der Hauptstadt die schriftlichen Arbeiten und war im Übrigen stets auf dem Sprung uns irgendeine Handreichung zu tun. Er hatte auch von den schönen, schwedischen Bädern erzählt und von den wunderbaren Massagen, die dort in der Mode sind. Dafür müsste er nun jeden Morgen den Feldwebel M. mit Stroh abreiben. Als Letzter fällt nun bloß noch der Gefreiter Röhr, ein guter Viehhändler aus Tr. Er war ein kleiner, dringlicher Kerl mit einem runden und glatten Gesicht. Der Oberleutnant nennt ihm schließlich bloß noch „Dickerchen“. Dickerchen sorgt für Kaffee und Tee und schmiert die schönsten Butterbrote. In der Kiste, die eigentlich für das Schusterhandwerkszeug bestimmt war, hatte er stets Wurst und Butter oder Schmalz. Oftmals hatte er den Kram aus seine eigene Tasche bezahlt und nahm kein Bargeld wieder an. Er war stets Hilfsbereit und leicht zu Tränen geführt. Ein wahres Grausen hatte her für die Schießerei. Es kam die Rede davon, er soll Unteroffizier werden und dann in der Front. Dann sagte er: „Na, Herr Oberleutnant, das doch nicht. Lieber nehmen sie mir die Knöpfe.“ Na, das war ja auch mal aus Spaß genannt, und er blieb bei dem Lager. Wenn nun als künftig vom Stab die Rede ist, dann sind meist immer al diese lieben Leute gemeint. Wie sieht das nun also im Feldlager aus? Hier saßen einige Leute und spielten Karten, andere hockten beim Kochloch und schmorrten sich irgendetwas zurecht. Zwei ganz findige Köpfe hatten sich aus Latten und Bretter kleine Verschläge gemacht, die gegen Wind und Sonne schützen sollen und lagen nun dort auf dem Rücken und schliefen den ganzen Tag immer. Andere haben sich Tisch und Bänke gezimmert, wo sie nun gemütlich saßen und Briefe schrieben oder auch tüchtig mit Nadel und Faden arbeiteten. Aber nicht jeder konnte tun was er wollte, welche mussten auch für allgemeine Dienste sorgen. Die Schlachter müssten Fleisch teilen und aufhängen, die Koche mussten für die ganze Kompanie kochen. Zwei schöne große, verzinnte Kupferkessel haben sie noch in der Soldauer Kaserne gefunden und wurden auch den ganzen Feldzug mitgeschleppt. Wieder andere mussten beigehen und gegen Wind eine Latrine bauen, damit das freihändige Geschäft endlich angenehm war. Man konnte sich im düsteren nicht recht in die Umgegend wagen. Ich selber bekam auch noch Arbeit. Da wir aus der Stadt einen großen Ballon mittels Leinentuch bekamen, musste ich das nun in kleiner 4-eckige Stücke schneiden, die auf die Tornister klappen aufgenäht wurden sollen, damit unsere eigene Artillerie uns von hinten besser kennen soll und uns von Russen unterscheiden soll. Wer keinen Tornister trug, also die Radfahrer und Reiter, bekamen so einen Flicken direkt auf dem Buckel. Ganz in der Hecke war der Kantinenwagen, der natürlich auch immer belagert war. Einer hatte sich aus der Stadt eine große Flasche mit Brandwein geholt, ich glaube ganz billig, denn dort war ja keiner, der das Geld in Empfang nahm. Die Trinkbecher voll, das gerade ¼ Liter, kostete bei uns 20 Pfennig. Als er merkt, dass seine Flasche schnell leer wurde, goss er noch eine hälfte Wasser hinzu und schlug er noch einen Groschen auf. Der Kerl hatte solche Preise, dass es alles nicht mehr schön war. Welche von uns Kerlen waren ihm hinterher auf die Schliche gekommen und gingen nun, obwohl es verboten war, in die Stadt und holten selbst eine Flasche voll Brandwein aus der Brennerei.
Die Folgen blieben natürlich nicht aus, abends war die halbe Kompanie stock betrunken.
Die Wachhabende und die Posten haben auch so einen sitzen, das wir sie ablösen mussten. Natürlich behaupteten sie steif und fest, sie haben keinen Schnaps gesehen. Wir holten mehrere Flaschen aus den Taschen heraus und nahmen sie mit. Den anderen Morgen hatte noch ein solcher Kerl die Frechheit und fragte, ob er den Schnaps nicht wiederbekommen kann. In einem Keller von der Brauerei war noch massenhaft Bier. Unser Feldwebel ließ nun zwei kleine Behälter holen und verteilte das Bier in der Kompanie. Das war auch so ein Jucks, dass ich bloß einen Schluck davon probiert habe. Den anderen Tag haben die meisten „Schnelle, mach‘ hurtig“. Nun muss ich noch ein Stück erzählen, was hier passiert ist. Das war nämlich so komisch. Dicht bei unseren Feldlagers Platz stand so ein kleines Haus mit einer Scheune und Stall. Das Haus war verschlossen. Unsere Kompanie stand gerade beim Appell, da sah einer von uns, dass dort eine alte Frau an gehumpelt kam, aufschließ und hineinging. Bald dorthin schlängelt sich eine Mannsperson dorthin und verschwand auch im Haus. Als der Appell vorbei war, meldete der Betreffende, der dies beobachtet hatte, diesen Vorgang den Oberleutnant. Das könnte ja möglicherweise wieder ein Spion sein. Na, unser Oberleutnant ging nun in das Haus hinein, um die alte Frau zu überprüfen. Von irgendeiner Mannsperson war überhaupt nichts zu sehen. Dann mit einem Mal, wir standen grade herum und erzählten uns etwas, springt aus dem Hinterfenster der Kerl heraus. Wir hinter ihm dran und riefen: „Stopp! oder wir schießen!“ Na, wir haben ja gar keine Waffen bei uns, der Kerl stand dann doch und entpuppte sich als ein alter Landwehrmann von der 8. Kompanie. Er hatte der Frau eine Mark gegeben und sich ein bisschen amüsiert. Mittlerweise hatte die Frau gelogen, sie hätte keinen Kerl beherbergt. Als wir nun mit dem Kerl zurückkamen, dann sagte das freche Ungeheuer: „Ja, Herr, was soll ich machen, die Zeiten sind schlecht, die Russen sind bei mir gewesen und haben nichts bezahlt, nun habe ich eine Mark bekommen und nicht gefreit!“ Zum Teufel noch mal! Uns wurde ganz schlecht und wir gingen alle. Das olle Weib wurde arretiert und so lange auf der Stadtwache festgehalten, bis wir dort weg waren, damit unsere Leute gesund bleiben. Ich möchte hier gleich bemerken, dass dieser Fall ziemlich vereinzelt dasteht und sich im weiteren Verlauf von dem Feldzug keine von unseren Leuten, sie waren ja fest alle verheiraten, so verführen ließ.
[/read]
[read more=“So trostlos wie das Wetter. (3. September 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (3. September 1914)“]
Am 3. September wurde morgens bei Zeiten das Feldlager abgebrochen, denn wir sollen nun nach Russland herein und die Stadt Mlawa besetzen und befestigen. Wir marschierten los und kamen bei Illowo an die Grenze. Auf dem ganzen Weg dorthin mussten wir uns oft die Nase zuhalten, denn einen ganz scheußlichen Verwesungsgeruch verpestete von Zeit zu Zeit die Luft. Dort lagen noch überall in den Chausseegraben und auf den Acker Kadaver. Wir sahen dies auch in der Zukunft immer, wenn uns so ein sanftes Lüftchen angeweht kam. „Hier rückt es nach Soldau“ Auch dieses Ankündigungskommando hält sich jeder die Nase zu. Illowo ist ein großes Dorf und die Grenzstation für die Bahn, da über Mlawa nach Warschau führt. Der Ort hatte einige große, moderne Häuser, Hotels und Warengeschäfte und schien in Friedenszeiten durch den Grenzhandel sehr floriert zu haben. Nun war alles total verbrannt und zunichtegemacht. Von all den großen, hohen Häusern standen bloß noch die Hausmauern. Ein großes, neues Schulhaus, das ganz nach besten städtischen Muster eingerichtet worden ist, war völlig demoliert. Die ganzen Schulbänke und Tische standen draußen auf dem Acker. Außerdem haben die Russen alle möglichen anderen Möbel herausgestellt. Dort standen auf dem Acker Sofas und Lehnstühle, die die Bequemlichkeit im Feldlader bedeutend erhöht haben. Bei der Grenze wurde das Land, das von Soldau bis hierher flach und grad verlief, wieder hügelich und ist mit niedrigen Tannenholz bestanden. Sowie man über die Grenze kommt, hört die Chaussee auf und der Weg geht in tiefen Sand über. Wir fingen an, kräftig über die Russen zu schimpfen, da das Geld bei Kriegsführern landet und sein Land in so einem jämmerlichen Zustand ließ. Schade, dass wir nun keinen Russen hier haben. Bei dem Anblick von den Trümmern von Illowow waren wir wieder in Wut gekommen. Der Marsch nach Mlawa soll ja ganz friedensmäßig vor sich gehen. Bloß eine kleine Spitze war vorausgeschickt. Wir waren ungefähr ½ km über der Grenze, da hörten wir vereinzelt ein leises Flauten über unseren Köpfen. Was war das? Dort schossen ja welche auf uns! Rasch wurden einzelne Gruppen auf die Hügel links und rechts in das Gebüsch hingeschickt, um dort nach feindlichen Patrouillen zu suchen, denn was soll hier wohl anderes sein? Wir waren kaum ein Stück weitergekommen, dann setzte es mit einmal vor uns hinter der nächsten Hügelkette – Bumm! und mit Gefühl kam eine Granate auf uns los. Na, das war ja eine Überraschung. Die vordersten Abteilungen von uns wurden nun rasch entwickelt und in Schützenketten wurden nun die Höhen vor uns besetzt. Unsere Artillerie führte auf und verschanzte sich aufs Beste. Bald standen die Häuser von einem kleinen Dorf in hellen Flammen. Nun bekamen wir auch kräftiges Infanteriefeuer. Aus dem Dorf mussten die Russen nun heraus, denn das wurde ihnen dort zu heiß. Wir rückten nach. In kleine Abteilungen, immer 1 Gruppe zurzeit, mussten wir in Laufschritt über eine kleine Brücke, die auch zur Hälfte verbrannt war. Jenseits hatten wir einen Augenblick Deckung, mussten bald auf einem Hügel herauf und hatten nun vor uns den Ort Wolka, der von den Russen besetzt wurde. Wir lagen hier nun stundenlang in Maschinengewehr- und Artilleriefeuer. Wo summt uns das über den Kopf. Wir fühlten richtig, wie die Maschinengewehre hin und her sprengten. Bald loderte auch Wolka in Flammen und der Lichtschein fiel auf die vor uns besetzten Höhen, so dass der Feind, der in den Grund in Graben Stellung hatte, uns gut in die Füße holen kann, sowie wir über den Kamm herüberkamen. Unter anderem war hier der Feldwebel Awe von der 6. Kompanie. Er war ein netter, ruhiger Mann. Schließlich im düsteren bekamen wir Holz von der 9. Kompanie, die in der Umgebung waren und nun vor der Flack kamen. In Sturm wurde nun der Ort eingenommen. Abends nach 10 Uhr waren wir in seinem Besitz und stellten unser Lager am Dorfrand, dicht an den brennenden Häusern. Aus Scheunen, die alle brennende Tieren hatten, holten uns Leute Stroh heraus zum Lager. Zelte wurden nicht aufgestellt. Bretter und aufgestellte Türen stellten wir hochkant, damit die Flammen nicht unser Lagerstroh verzehren sollen. Die erste Portion Konserven wurden aufgemacht. Mit Lust schimpften unsere Leute, hier können sie doch auch ihre Wut auslassen, wir waren ja nun im Feindesland. Ab und an gab es in den brennenden Häusern ein Geknatter, als wenn wir mit Salven beschossen werden würden. Es waren Explosionen von der Munition, die die Russen dort haben liegen lassen. Das war ein sonderbares Schlaglied, was uns die Feuersbrunst singen ließ, das Knistern und Knastern und das Abfallen der Giebel. Wir sind hier doch ganz gut eingeschlafen. Mitten in der Nacht setzte strömender Regen ein, Ich glaube, mit kleiner Ausnahme war das das erste Schlachtwasser. Wir waren bisher richtig verwöhnt. Freilich waren die Nächte auch richtig kalt geworden. Nun war unsere Stimmung so trostlos, wie das Wetter.
[/read]
[read more=“Donnerwetter! (4. September 1914)“ less=“Donnerwetter! (4. September 1914)“]
Am 4. September bei Tagesanbruch kam noch aus einzelnen, unversehrten Häuser Feuer, und zwei von Leute wurden noch verwundet. Wir mussten antreten und standen nun zwei Stunden im Regen herum, während andere Truppen auf anderen Wegen die Gegend um Mlawa herum besetzen. Schließlich kam unser Gepäck nach, welches wir sehnlichst erwartet haben, weil wir nichts mehr zu essen hatten. Nun wurden einige Konserven empfangen und aufgekocht. Der Regen hört allmählich auf und auch unsere Stimmung schlägt wieder um. Je mehr der Hunger schwindet, je größer wurde unsere Stimmung. Wessel kam ganz geheimnisvoll an und sagte zu mir: „Ach, Herr Feldwebel, kann ich sie wohl einen Augenblick sprechen?“ Dabei sagte er es so blöd, als wenn ein großes Unglück passiert wäre. Er sah auch so aus, als wäre über Nacht etwas passiert. Ich ließ also die Leute, mit dem ich gerade im Gespräch war, stehen und ging mit ihm nun in eine Ecke von einem Haus. „Na, was ist los?“ sagte ich. „Ach, Herr Feldwebel“ antworte er. „Ich möchte doch ein bisschen für den Stab sorgen, das brauch ja keiner sehen“. Und damit langte er unter seinem Rock und holte dort eine schöne Rügenwalder Mettwurst heraus, so lang wie ein halber Arm. „Menning“, sagte ich. „Wo haben sie die her?“ „Die hatte ich aufgespart, in Soldau“. Er gab mir dazu noch 2 Pack Konserven, die erste Not war wieder vorbei. Schleunigst ging ich zu Klemann, den ich nun auch geheimnisvoll wirken ließ. „Na, was haben Sie schon wieder gutes?“ sagte er und kam neugierig heran. Stets aller Würde hielt ich ihm die Wurst unter die Nase. Oh, was leuchteten seine Augen hinter den Brillengläsern. „Donnerwetter!“ sagte er bloß. Nun würde dann ehrlich erzählt und dann kam auch bald der Befehl zum Einmarsch nach Mlawa. Wir gingen nun ganz durch Wolka durch und kamen durch eine hübsche Allee, die zu beiden Seiten bebugt war nach sich gleich anschließende Mlawa. Die meisten Einwohner haben den Ort verlassen und bloß einige waren noch dageblieben. Sie könnten doch noch ein Geschäft machen. Unser Bataillon blieb vorläufig nicht in der Stadt. Wir mussten durchmarschieren und bildeten feste Schanzen. Ich bekam den Auftrag mit 15 Mann als linke Seitendeckung auf Feldwache zu ziehen. „Verpflegen müssen Sie sich selbst durch Beitreibung“, sagte der Oberst. „unsere eisernen Portionen sind seit gestern verbraucht“.
Na, das war ja nun das erste Mal, dass wir rein Garnichts kriegen.
„Schön“, sagte ich „wir werden schon etwas finden.“ Ich rückte also aus und ließ mitten auf einem Acker unter einem großen Baum, der gleich ein bisschen gegen Regen schützen soll, unser kleines Zelt aufschlagen. Einen Durchlassposten stellte ich auf, die Kerle mussten sich dort eingraben. Ich schickte nun zwei Patrouillen aus, der, unter ihren Auftrag nach den Feind aufzupassen, auch die Weisung kriegen, in die nächsten Gehöfte nach Essen zu furagieren. Währenddessen mussten andere Stroh holen, so dass das im Zelt sich ganz schön liegen lässt. Mittlerweise war das überall düster geworden und die Patrouillen kamen mit langen Gesichtern zurück. Sie haben nichts bekommen, nur ein kleines Stück Brot. Den anderen Morgen sollen sie aus einem Stall Milch holen. „Waren denn keine Gänse dort?“ fragte ich. „Das war alles so düster, wir haben kaum noch den Weg gefunden“ sagten sie. Na, dann müsste anders satt werden. Ich holte also meine beiden Pack Konserven heraus und bei einer Umfrage fanden sich noch 3 Pack bei den Leuten. Vom nächsten Hof Wasser geholt und die Konserven geholt. Jeder bekam nun zur Suppe ein kleines Stück Brot und dann kriechen wir ins Zelt. Ruhe bekam ich natürlich nicht, denn ich musste ja gut aufpassen, dass der Posten immer richtig abgelöst wird und die Patrouillen richtig gingen. Die Nacht war sehr kalt. Regen und Wind setzte gegen Morgen wieder ein. Das war recht ungemütlich. Seit 14 Tagen trugen wir nun die Stiefel und das tat uns nicht mehr gut. Wir soll es nun erst so im Winter werden, wenn es nun so kalt wird? Na, so ein olles Regenwetter gibt doch gleich schlechte Stimmung.
[/read]
[read more=“Ein Schlaraffenleben. (5. September 1914)“ less=“Nach der Schlacht. (3. September 1914)“]
Als es nun wieder Tag geworden ist, musste Patrouille Nr. 1 wieder zu dem Gehöft hin, wo es Milch geben soll. Führer war, wenn ich mich nicht irre, Gefreiter Karl, ein Gastwirt aus Negast. Nach 1 ½ Stunden kam sie wieder und schwenkten etwas von weiten durch die Luft. Wir wurden sehr neugierig. Außer einen großen, eisernen Pott, in denen sie 4 Liter Milch hatten, brachten sie 4 junge Hühner mit, die alle zerpflückt und ausgenommen waren. Hurra! Das war fein. Zuerst wurde die Milch aufgekocht und gleich warm ausgetrunken. Jeder bekam 1 Trinkbecher, welcher einen viertel Liter fasste. Nun wurden dann rasch auf dem Acker Kartoffeln ausgebuddelt und die Hühner in einen großen Blecheimer auf das Feuer gestellt. Die Kartoffeln kamen im eisernen Pott und nun wurde Mittag gekocht. Wie standen wir alle neugierig um das Feuer, wie waren wir stolz, als bei den Hühnern sich die Manschetten umkrempelten und die feine Kochen so lang dauerte. Über Hühnerfleisch ist ja man nüchtern und dort musste richtig Salz heran. Jeder musste ja ein bisschen dazutun und schließ war die Suppe versalzt worden. Aber das schadet ja auch nicht, dann brauchen wir die Pellkartoffeln nicht mehr in Salz stippen. Die Hühner selbst waren aber so zart geworden, das die Hinterbeine beim Anfassen alle abgebrochen sind. Auf 4 Mann kam ein Huhn. Das war eine prachtvolle Mahlzeit. Im Laufe des Tages kam Klemann bei mir zu Besuch. Sie haben bei der Kompanie Kaffee gekocht und er kam nun 600 Meter über den Acker gestoppt und brachte mir einen Trinkbecher voll Kaffee. Er ging wie auf Feuer, damit das nicht überlaufen soll. Außerdem hatte er noch 2 dünne Schnitten Kommissbrot und ein Päckchen Thorner Honigkuchen. Er wollte mich doch nicht verhungern lassen. Möglicherweise hatte er sich selber aufgespart. Ich habe ihn das sehr angerechnet. Als ich ihm nun erzählte, wie nobel wir gegessen hatten, da kam er aus dem Staunen gar nicht heraus. Bei der Kompanie haben sie auch beinahe hungern müssen. Nachmittags über sollen wir abgelöst werden, um 3 Uhr soll ich mit meiner Kompanie antreten und dann soll unser ganzes Bataillon in die Stadt herein in ein Quartier. Na, so wurde es dann auch gemacht. Wir marschieren in die Stadt ein und wurden dort einquartiert. Ach, was war das für ein Genuss, sich in ein richtiges Haus niederzulassen und sich einigermaßen häuslich einzurichten, nachdem wir wochenlang kein Dach über Kopf und keine Stiefel vom Bein abhatten. Mit Vergnügen streckten wir uns auf die Strohsäcke aus, mit den wir denselben Fußboden verziert hatten. Einige von uns Leuten, die besonders findig waren und auch einen recht weites Gewissen hatten, revidierten in der Nachbarschaft Keller und Speisekammern und kamen mit allerhand Eingemachtes zu Platz. In unserer Küche wurde das bald lebhaft und bald trug sich ein prachtvoller Kaffeeduft durch das ganze Haus. Zum Überfluss war noch Post angekommen und auch ich war so glücklich Brief und Päckchen zu kriegen. Neben anderen bekam ich Schokolade und Zigarren, beides stets willkommen. Ich wälzte mich entspannt mit meinem Glimmstängel auf einem Strohsack und stellte mir das vor, wie schön der schlaf in dieser Nacht wohl sein wird, dann fing das mit einmal auf der Straße an zu tuten und wir mussten uns rasch fertigmachen und auf dem Alarmplatz antreten. Das war eine schöne Bescherung. Als wir 10 Minuten dort standen, kam unser Bataillonskommandeur und sagte zu uns, sie hatten sich so sehr gefreut, dass wir so fix herausgekommen sind. Das wurde bloß eine Probealarmierung durchgeführt. Na, uns soll es nicht weiter stören und mit Vergnügen suchten wir unser Quartier wieder auf und schliefen dann. Am anderen Morgen, Sonntag den 6. September, rückten wir wieder aus der Stadt heraus und verbesserten die Schützengräben. Für die ganze Kompanie wurde dort gekocht und bald saßen die Mannschaften beim Essen. Welche von unseren Rheinländern waren sangeskundig und bald haben sich die richtigen Leute zusammengefunden, hatten ihre Gesangsbücher herausgeholt und singen mehrstimmig zwei Chorale. Die anderen stellten sich drum herum und hörten zu, oder summten mit. Auf diesem Weg kam auch der Sonntag zu seinen Recht und bekam einen zierlichen Anstrich. Nachmittags kamen wir wieder ins Quartier, zu unseren Plätzen. Hinter dem Haus waren schöne Obstgärten, die natürlich sehr herhalten mussten. Dazu all die anderen schönen Sachen, Himbeeren und Marmeladen. In der Stadt waren mehrere Millionen Eier beschlagnahmt, die alle in Kisten verpackt zum Versand bereitstanden. Diese wurden nun unter den Mannschaften verteilt und einige hatten sich damit das Leben vollgeschlagen. Mir ist besonders einer von unseren Männern in Erinnerung. Das war ein Wehrmann Franke, der schlug sich 20 Eier mit einmal in den Bauch und aß sie glattweg auf. Unser Gepäck war inzwischen auch angekommen und Wessel hat unterwegs zwei Pfund Molkereibutter gekauft. Nun ging nach all der Entbehrung in der letzten Zeit ein wahres Schlaraffenleben los.
[/read]
[read more=“Erwartung auf einen Angriff. (7. September 1914)“ less=“Erwartung auf einen Angriff. (7. September 1914)“]
Der 7. September ging ebenso her. Morgens ein bisschen an den Schützengräben gebuddelt und zu Mittag wieder ins Quartier. Nachmittags kam ein russischer Flieger über die Stadt und wurde von uns heftig beschossen. Er soll ein Ende hinter der Stadt erhalten haben. Während wir hier nun faul herumlagen, wurden schon einige von den Truppen, die die Tannenberger Schlacht miterlebt haben, austransportiert, um wieder wo anders zu kämpfen. Nur unsere Brigade blieb hier. Der Russe musste dies auch wohl merken, dass wir hier von Tag zu Tag schwächer wurden und so zeigten sich dann bald in der Gegend wieder russische Abteilungen. Um nun mal gewaltsam aufzuklären und dieser Sache näher auf dem Grund zu gehen, wurde am 8. September vom 1. Bataillon eine Abteilung zusammengestellt, die in der Führung von unseren Leutnant Lange eine Streife in der Umgebung vornehmen soll. Um die Abteilung beweglicher zu machen wurden einige Wagen requiriert und der ganze Schwung rückte in die Stadt. Ich musste mit 12 Mann nach einem großen Proviantspeicher auf Wache. Der Betrieb dort war für mich sehr interessant. In der Hauptsache waren dort ja russische Vorräte, aber auch von unseren Kolonnen waren dort alle große Mengen von Konserven und Brot gelagert. Abends kam eine Abteilung von dem Landwehr-Infanterie-Regiment-9 in die Stadt, die alle wieder mit Russen beschäftigt waren und schwer gelitten haben. Auch unsere Streifkolonne kam zurück und hatten die Russen begegnet und dadurch ein M. G. eingebüßt. Die ½ beigegeben, schweren Reiter waren versprengt und fanden sich erst 2 Tage später einzeln wieder zusammen. Es schien also so zu sein, das größere, russische Abteilungen nach Mlawa anzurücken zu scheinen. In Erwartung auf einen Angriff wurde um 11 Uhr nachts alarmiert. Auf dem Proviantamt ging nun eine fieberhafte Arbeit los. Unsere Gepäckwagen wurden mit Lebensmittel voll beladen, was sie halten konnten, um doch möglichst viel von den Vorräten zu bergen. Mittendrin wurde eine große Flasche Petroleum herumgerollt und eine Axt dabei gelegt, um im gegebenen Augenblick den ganzen Kram in Brand stecken zu können. Der Angriff erfolgte jedoch in dieser Nacht nicht und am anderen Mittag, den 9. September wurde meine Wache eingezogen und unser Bataillon rücke aus Vorsicht in nordöstliche Richtung über Kuklik aus. Die ganze Brigade folgte. Wir marschieren bis in die späte Nacht und meine Kompanie kam bei Wieczfnia auf Vorposten, ich selber auf Feldwache. Das war eine helle, sternklare Nacht. Am Horizont sahen wir einen großen Feuerschein, der jedenfalls von dem beim Abzug auf Mlawa in Brand gesetzten Speicher herrühren ließ. Als Feldwache durfte ich ja nicht schlafen, und so lag ich dann mit offenen Augen auf dem Acker und guckte den Mond an, derselbe Mond, der nun auch wohl bei meinem lieben Zuhause in das Fenster schien.
[/read]
[read more=“Mein kleiner Junge. (10. bis 14. September 1914)“ less=“Mein kleiner Junge. (10. bis 14. September 1914)“]
Um Mitternacht, am 10. September, hat mein kleiner Junge Geburtstag. Meine Gedanken waren zu Hause und ich habe im Stillen mit meinem Herrgott gesprochen. Ich war durch das Soldatenleben richtig in der Stimmung. „Ich in finsterer Mitternacht“, so schön man es auch ausdrücken konnte. Nach eingetroffenen Meldungen schien es so, als wenn stärkere, russische Kräfte sich wieder nach Norden in die Richtung auf Neidenburg bewegten. Mit Tagesanbruch mussten wir daher antreten und versuchen, uns in Eilmärschen zwischen den Feind und der Grenze zu drängen. Bei Janowo – Kamerau überschritten wir um 3:15 Uhr nachmittags wieder die Grenze und besuchten das letzte, auf deutscher gelegene Feldlager. Das wir nun wieder auf deutschen Boden waren, brauchte keiner von uns sagen. Auf russischer Seite ist alles verwahrlost. Der Acker ist dort so mit Steinen besäht, dass er mehr eine Wüste gleicht. Die Wege heben sich bloß dadurch von dieser Wüste ab, dass sie noch weniger gangbar sind. Die ganze Kultur ist dort eine andere. Bei uns gleich schöne, glatte Chausseen mit Alleebäumen, die jüngsten haben die Russen allerdings alle umgehaut. Für sich ist die Gegend hier durchaus reizvoll. Hügelgelände von beträchtlicher Höhe mit viel Wald. Dazwischen gestreute Seen und auch Sümpfe.
Am 11. September marschierten wir noch ein wenig ins Heimatland herein und gingen bei Sawadden in Stellung. Unsere Artillerie führte hier ebenfalls auf. Wir sperrten hier zwischen Hügelkette und See die Straße, uns war die Situation gar nicht geheuer, da wir auf einen flachen Präsentierteller lagen. Gegen 18:30 abends wurde unsere Kompanie zurückgeschickt und wir gingen in ein Feldlager zwischen den Häusern in der Nordhälfte von Sawadden. Hier erreichte uns die frohe Botschaft von dem Sieg bei Verdun und eine gewonnene Schlacht nördlich des Spirdingsees. Für mich persönlich war dieses Lager noch das angenehmere, da mich der Kompanieführer einlud, von nun an mit in seinem Zelt zu schlafen. Ich habe nämlich, da Leutnant L. am 9. September Regimentsadjutant geworden war, den ganzen 2. Zug selbstständig übernommen.
Nach einer recht schönen, warmen Nacht, rückten wir am 12. September wieder in die richtige Stellung, aus der wir nachmittags abgelöst wurden und marschierten nach Groß Grabowen. Hier wurde aufgekocht und wir mussten stundenlang im Regen bereitstehen, weil sich bei Sawadden ein Gefecht entwickelt hatte. Endlich um 11 Uhr abends war es vorbei und wir verbrachten eine angeschlagene Nacht.
Am Sonntag den 13. September mussten wir uns auf die Höhen von Groß Grabowen verschanzen. Der Russe kam bei Sawadden an – Wir können den Artilleriekampf von hier aus schön beobachten. Es sah beeindruckend aus, wenn die russischen Granaten in den See reinschlugen und riesigen Fontänen des Wassers aufschlugen. Unsere Artillerie bekam bald die Überhand und nun gingen wir zum Angriff über. Bei Nowa Wies lagerten wir alle am Abend wieder auf russischen Boden. Es war kühl geworden, so dass nach und nach der Kompaniestab sich in Gebäuden gemütlich machte. In einem Schuppen stellte der Kompanieführer sein Pferd ab, das war dort ganz schön Eng, da auch Häckselblätter und das große Fuhrwerk dort standen. Und so kam es, das Dickerchen im Düsteren ein Stallfenster berührte, was unserem Oberleutnant gerade auf die Nase fiel. Verdammt noch mal, was bekam er für einen Schreck. Immerhin war er froh, dass er nicht von irgendeinem Kosaken auf die Nase bekommen hat. Sein Schallen ging bald in Grummel über und verlor sich bald wieder in das schönste Schnarchen.
Am 14. September Vormarsch, über Salense, wo wir Rast machten. Während ich mir hier von einem Landsmann Falk von der 8. Kompanie nach längerer Zeit mich wieder rasieren ließ, brachte Berge für sich, Klemann und mich zwei Tauben. Er hatte noch ein kleines Stück Speck im Brotbeutel gehabt, hatte es dann in dünne Scheiben geschnitten und damit die Tauben schön bewickelt. Nun war das Gericht gut gelungen und wenn man beim Braten nicht soviel Sand in dem Kochgeschirrdeckel hatte, hätte es noch schöner geschmeckt. Bei Trzcomki trat das Bataillon auf Vorposten. Unsere Kompanie als Vorpostenkompanie, ich mit meinem Zug ½ Kilometer wieder bei Przedborz auf Feldwache. Seit vergangenen Morgen hatte die Kompanie keine Verpflegung bekommen, weil das Gepäck nicht hätte folgen können. Endlich, nachts um 11 Uhr, kam die Feldküche an. Mit der Feldküche war es in dieser Zeit ein elend. Bei Tannenberg hatte das Bataillon 2 russische Feldküchen erorbert. 2 und 2 Kompanien mussten sich nun immer das kochen teilen. So kam es, dass von einer regelmäßigen Verpflegung auf dem Vormarsch keine Rede sein konnte. Eine eigene, deutsche Feldküche bekamen wir erst im Januar 1915.
[/read]
[read more=“Mir schwant nichts Gutes. (15. bis 18. September 1914)“ less=“Mir schwant nichts Gutes. (15. bis 18. September 1914)“]
Am 15. September sammelt sich die ganze Division bei Dobrogosti und setzte den Vormarsch fort. Unser ganzes Bataillon kam abends auf dem Gasthof Dzierzgowo unter Dach.
Am 16. September wieder Vormarsch über Dzierzgowo – Szumsk, Borkowo Falenta. Rast machten wir in Borkowo-Boksy. In der Stadt Przasnysz kamen wir nachmittags um 16:30 Uhr an. Przasnysz liegt in einer weiten, flachen Ebene, die nach Norden hin von Hügelketten umgeben ist. Als wir die letzte Hügelkette von Norden her überschritten, ballert eine Artille, die dort aufgeführt war, zwei große Schrapnelle zu der Stadt herüber und schloss sich uns an. Das war ein famoses Bild, was sich uns in die Ebene bot. 3 Brigaden in langen Kolonnen schlängelten sich aus verschiedenen Richtungen an der Stadt heran, die von den Russen kampflos geräumt wurde. Hier konnte man richtig von dem Heereswurm sprechen, der sich durch das Land wälzt. Zu gleicher Zeit kamen die Spitzen von diesen 3 Kolonnen vor der Stadt an und nach kurzer Rast vor der Stadt wurden uns die Quartiere zugewiesen. Es war schon schummerig, als wir in der für uns bestimmten Straße ankamen. Für den Kompaniestab war ein kleines Haus bestimmt, das von innen einigermaßen freundlich aussah. Die meisten Häuser waren hier verbarrikadiert und mussten erst mit Gewalt aufgeknacht werden. Als ich mienen Zug unter Dach und Fach hatte, ging ich zu meinem Quartier, dort hockten alle im Dunkeln. Dort waren zwar 2 Lampen, aber kein Petroleum. Ich schickte den Burschen von dem Oberleutnant in die Stadt herein, um Petroleum zu bekommen. Er kam auch bald mit einer Flasche voll wieder. Ich setzte die Flasche oben auf der Treppe ab und ging in die andere Stube, um die Lampen zu holen. Inzwischen war nun auch unser Gepäck angekommen und der Unteroffizier Franke brachte ein schönes Stück Fleisch mit, das nun gebraten werden soll. Ich stand gerade noch dabei und guckte zu, wie das Fleisch in Scheiben geschnitten worden ist, da machte es nebenan „klingling“, als wenn Polterabend war. Mir schwant nichts Gutes. Ich stürmte in die Vorstube und dort stand mein Freund Klemann in eine großen Pfütze Petroleum. Er hatte im dunklen meine schöne Petroleumflasche kaputt gemacht. Na, das hilft nun ja nicht. Im Tornister fanden sich noch zwei Tücher, womit das Petroleum so gut wie es ging, aufgewischt wurde. In einem Schrank fanden wir Teller, Messer und Gabel. So wurde es eine feine Tafel an einem großen, runden Tisch. Der Bratenduft aus der Küche vermischte sich mit dem Petroleumgeruch vom Fußboden zu einem herrlichen Odeur, dazu die prächtige Beleuchtung. Kinnings, was waren wir fein. Hierzu gab es noch Butter und der Oberleutnant spendiert noch eine große Zigarre dazu. Zum Überfluss kam Dickerchen noch mit einem großen Haufen Birnen an, die er unterwegs requiriert hatte. Nun hatten wir auch einen Nachtisch. Bald wurde auch Stroh auf dem Fußboden verteilt und wir schliefen hundemüde ein.
Der andere Tag, 17. September, war ein Ruhetag. Ich ließ daher meine Quartierkameraden ein bisschen Wäsche holen und ging derweil zu einem kleinen Bummel in die Stadt, in der es von Soldaten wimmelte. Außer den Kasernen, Kirchen und Kloster, waren alle Häuser aus Holz. Bemerkenswert war das Innere der Klosterkirche, die einige sehr schöne, alte Kunstwerke beherbergte. Mittags um 12 Uhr bekam unser Bataillon den Befehl auf Vorposten zu gehen. Meine Kompanie blieb jedoch nicht weit von der Stadt entfernt und so kamen wir auch mit 3 Kompanien unter. Dort machten wir uns mit ein bisschen Stroh gemütlich. Es war schon sehr düster, dann hörten wir mit einmal eine Mandoline. Ein Mann von einer anderen Kompanie hatte sich so ein Ding gekauft und klimpert nun damit los. Bald sinnten sich auch 2 Sänger dazu und mehrstimmige Gesänge wechselten gesungene Volkslieder ab. Zwei besonders beanlagte Leute trugen auch Solos vor. Dort stach sich besonders Wehrmann Storch 8/2 vor, welcher ein richtiger Komiker war. Zum Schluss hielt noch Oberleutnant Erdmann von der 8. Kompanie eine kleine Rede. Abends gegen 10 Uhr kam noch Post, die sich bei manchen hügelweise aufgesammelt hatte. Bei dürftigen Kerzenschimmer wurden noch rasch die Briefe überflogen. Beruhigt über das Schicksal von unseren Lieben zu Haus, schliefen wir ein.
Über Nacht fing es an zu regnen und bei strömenden Gewitter mussten wir am 18. September wieder marschieren. Bis an die Enkel gingen wir durch den Morast. Wir gingen durch das Dorf Wola und kamen auf einen Gutshof Rambiessz, in einer großen Scheune unter Dach. Das Gehöft war völlig verlassen. Berge ging auf Entdeckungsreisen aus und fand im Gutshaus einen großen Vorrat prachtvoller Äpfel. Wir nahmen so viel wir wie konnten. Nachts wurde es ein fürchterlicher Orkan. Bei strömenden Regen marschieren wir am 18. September nach Brczyna wo sich das Regiment sammeln sollen. Stundenlang standen wir hier im Regen auf der Dorfstraße und warteten auf weiteren Befehl. Der Olle Hindenburg knobelte wohl eine neue Gruppierung aus und wusste mit uns nicht wohin. Welche von uns Leuten haben Durchfall bekommen. Das viele Obst und das nette Wetter waren wohl schuld daran. Schließlich kamen wir in kleinen Häusern, Scheunen und Ställen unter. Hier mussten die Leute zum großen Teil bis an die Knöchel in Mist stehen, denn so ein Stall wurde wohl niemals ausgemistet. Gegen Abend marschierten wir nach Rombiers zurück und betraten dort unser Nachtquartier. Unser Gepäck kam auch zu rechter Zeit an und so bekam ich in der Nacht noch eine warme Decke. Diese Nacht schlief ich sehr schön.
[/read]
[read more=“Ein Talent zum Schweinstreiber. (20. bis 24. September 1914)“ less=“Ein Talent zum Schweinstreiber. (20. bis 24. September 1914)“]
Der andere Tag, der 20. September, war ein Sonntag. Zur Feier des Tages brachte Berge uns wieder zwei Tauben, die prachtvoll schmeckten. Als Nachtisch aßen wir die schönen Äpfel. Als wir frischten Vorrat haben wollten, ließ uns der Oberst einen Schwung bringen, der für diese Nacht in das Gutshaus einquartiert wurde. Wie es hieß, war unsere Aufgabe in dieser Gegend nun erfüllt und wir sollten zurückgenommen werden. Ganz kluge Leute von uns meinten, wir kamen nun wieder als Besatzung nach Thorn, da man doch die Landwehr nicht so anstrengen dürfte. Für die Strapazen waren doch die aktiven und Reservisten Regimenter dar. Nachmittags kam auch der Befehl zum Abmarsch und das ging wahrhaftig zurück über Poschinek nach Detkensowo, wo meine Kompanie ins Quartier kam. Das Dorf bestand aus vieler kleiner Rentengüter und war ein parzelliertes Eigentum. Ein Gehöft betrat ich mit meinem 2. Zug. Die Mannschaften lagen alle in einer schönen, großen Scheune, ich selber war in dem Wohnhaus. Die eine Seite bewohnte der Eigentümer mit seiner Familie. Auf der anderen Seite, wo noch keine Fenster waren, wohnte ich. Nachdem der Oberleutnant die anderen Züge besucht hatte, die in entfernteren Rentengütern zerstreut untergebracht waren, kam er nach uns und quartiert sich nun ein. Feldwebel kamen auch noch zu mir. Am Abend gab es nach langer Zeit mal wieder Spiegeleier.
Da wir hier einige Tage Ruhe haben sollen, richteten wir uns nun am 21. September ein bisschen wohnlicher ein. Die Fenster wurden dann auch mit Bretter zugenagelt, weil es so fürchterlich zieht. Auf eine alte Kiste und einem Ochsengespann luden wir Bretter und machten uns so Tisch und Bank, darüber wurden Schlafdecken gelegt und die Sache sah bei uns direkt feierlich aus. Der Boden wurde voll Stroh gepackt, damit wir ein recht schönes Lager bekommen. Ich gab den kleinen Kindern von unseren Wirt Süßigkeiten und machte mir so die Leute zum Freund, die uns mit Eier und Butter versorgten.
Am 22. September requirierte ich in der Nachbarschaft einen schönen jungen Bullen und nun gab es zum Mittag Ochsenschwanzsuppe und Zungenragout. Franke und Dickerchen machten sich um die Verpflegung überhaupt sehr verdeckt. Endlich schien hier auch wieder die Sonne, so dass man sich ein bisschen zu Nachmittagsschlaf hinlegen konnte. Kurz vor Mittag haben wir eine kleine Aufregung gehabt, denn dicht bei uns platzten zwei Schrapnelle. Wir glaubten alle an einem Überfall. Doch es stellte sich heraus, dass unsere Artillerie aus Mlawa nach einem feindlichen Flieger geschossen hatte. Wir haben doch von sowas keine Ahnung.
Unsere Aufregung ging zu Ende und wir mussten doch bedacht sein. In ganz Detkensowo war kein Schwein.
Ich machte mir am Spätnachmittag mit zwei gewandten Leuten auf dem Weg zu den mit anderen Kompanien belegten Nachbarsdörfer und suchte dort heimlich die Ställe ab. Nichts zu finden. Endlich, das war schon sehr spät und fing an zu schummern, hörten wir in Zalesi, wo die 5. Kompanie lag, was grunzen. Ganz leise gingen wir den lieblichen Tönen nach und fanden in einem Stall 3 Schweine. Mit Licht und Tücke bekamen wir sie ohne viel Lärm dort heraus und dann schnell damit über den Acker nach Detkensowo zurück. Ich immer mit hochgeschwungenen Säbel hinten an, die Leute an der Seite, damit die Schweine nicht ausbrechen können. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Talent zum Schweinstreiber habe. Die Einwohner haben es wohl bemerkt und die 5. Kompanie alarmiert, wir waren aber im düsteren allzu weit weg, so dass sie uns nicht mehr erkennen konnten und wir hörten bloß noch das Gefluche hinter uns. Das wir bei unserer Kompanie festlich empfangen würden, brauche ich wohl nicht erst erwähnen. Zur Belohnung gab es am Abend Rumpsteak mit Pellkartoffeln. Dieser Ort gefiel uns ganz gut.
Am 23. September kam morgens und nachmittags wieder Post an. Vormittags wurde ein wenig exerziert. Unser Oberleutnant hatte gehört, dass in einem Nachbargehöft ein möbliertes Zimmer sein soll (1 Stahl und 1 richtiger Tisch). Er zog dahin um und nahm den zerstreuten 1. Zug mit dorthin.
Als ich am 24. September ausgeschlafen war und noch ein wenig still lag und in den Tag hereinschaute, fing der kleine Unteroffizier Mosler, der neben mir lag, an zu schnauben. „Na, was ist Ihnen denn?“ fragte ich. „Hier riecht es so komisch“ sagte er. „Wieso denn?“ frage ich. „Ja ich rieche es schon eine ganze Zeit, es riecht so streng“ sagte er. Mittlerweile hatte ich es auch gerochen und guckte meinen unruhigen Nachbarn an und fing laut an zu lachen. „Menning“, sagte ich, „stecken sie mal vorsichtig den Kopf hoch, aber stecken sie dann nicht die Nase herein! Er richte sich ein bisschen auf und „Pfui!“ sah er und sprang auf. „Wer hat das getan?“ Gerade auf seinen Boden, dicht unter dem Kinn lagen Kötel auf seiner Schlafdecke. Die Katze, die immer bei uns auf den Balken unter der Decke lag, hatte es wohl nicht länger halten können. Am Mittag kam nun endlich der Befehl zum Quartierswechsel und in einem halbstündigen Marsch kamen wir nach Nieborizyn, wo die Kompanie geschlossen untergebracht wird. Nach Süden haben wir einen weiten Blick über die flache Ebene, wo man etwa 15 km entfernt Liechanow sehen kann. Zur Ruhe sollen wir hier überhaupt nicht kommen. Nachts um 11:30 mussten wir abrücken, um wieder mal Jagd auf Gegner zu machen.
[/read]
[read more=“Wie ein nasser Pudel. (25./26. September 1914)“ less=“Wie ein nasser Pudel. (25./26. September 1914)“]
In der Gegend von Liechanow waren wieder russische Kavallerie, die nun zerstreut werden soll. Wir marschieren nun bei Nacht und Nebel durch Morast und Wald, zu dem Sammelpunkt des Regiments nördlich von Wola, wir am 25. September um 3:00 Uhr früh ankamen. Der Oberst wies alle auf dem Platz und bei brillanter Beleuchtung von Wagenlaternen, gab er an die Bataillonführer seine Befehle. Unser Regiment soll eine Umgehung machen und die Kosaken den Rückzug abschneiden, während von Liechanow aus andere deutsche Truppen bei Tagesanbruch angreifen sollen. Um 3:20 Uhr ging unser Vormarsch nach Süden über Busina – Rombiers – Gorne nach Opinogora, wo wir die uns angewiesene Stellung einnahmen. Weit in Schützenlinie auseinandergetreten, bildeten wir einen langen Riegel. Wir waren gerade hier eingetroffen, da ging die Sonne auf und in Liechanow fiel im selben Moment der erste Kanonenschuss. Wir gingen nun zweihundert Meter vor, kamen jedoch nicht zum Schuss, da Kosaken noch ein Loch gefunden hatten und entkamen. 50 Mann wurden bei Liechanow von der 9. Kompanie gefangen genommen. Auf unserer Seite waren 4 Tote. Unser Bataillon sammelte sich bei den Obstgärten von Opinogora, welches ein großes Gut war, und dürften dort ½ Stunde rast machen. Welche von uns nutzten die Gelegenheit zum Stehlen von Äpfel. Da dieses Geschäft immer stark betrieben wurde, wurde es verboten und Posten davorgestellt. Als es nun weitergehen soll, da war von dem Kompanieführer sein Pferdeholer nicht da. „Wo steckt der Kerl!“ rief der Oberleutnant und siehe da, dann kam uns der Freund Rienow aus dem Obstgarten. Er hatte nicht bloß die Taschen voll Äpfel gehabt, er hatte sogar seinen Helm abgenommen und diesen auch noch mit Äpfel vollgefüllt. Das war ein Bild für Götter, als er nun wie ein nasser Pudel vor dem Kompanieführer stand. Wir marschieren nun wieder zurück und machten ½ Stunde Rast. Über Lipa nach Gorne, wo wir nachmittags um 3 Uhr ankamen. 15 Stunden waren wir nun in einer Tour auf den Beinen. Wir wurden hier in Gorne für die gehabten Strapazen durch ein sehr gutes Quartier entschädigt worden. Wir 3 Zugführer haben für uns und unsere Kameraden ein kleines Haus bekommen. Wir haben nun ein Dach über den Kopf und die Stube war sehr gemütlich. Für die Nacht wurde Stroh hergeschafft. Da war auch ein Bettgestellt, welches wir den ältesten zur Verfügung stellten. Ich ließ aber vorsichtshalber die Betten herauspacken und bloß ein Lacken über den Strohsack legen. Die Wirtsleute blieben nicht locker und drängten uns mit Gewalt noch jeder ein Kopfkissen auf. Na, nach diesen anstrengenden Tag schliefen wir dann auch bald ein.
Nachts um 2 uhr wachte ich wieder auf, ich konnte das ganze Jucken über meinen ganzen Leib nicht aushalten. Ich hatte mich gar nicht umgeschaut, da ich mich so schnell hingelegt habe und suchte nun mit der Taschenlampe mein Bett ab. Und siehe da, dort waren ja wohl an die 100 Flöhe. Nun ging mir es mir wie Onkel Fritz bei Max und Moritz: „Und man sah mich voller Grausen eilig aus dem Bette sausen; doch schon wieder hatt‘ ich einen, im Genicke an den Beinen“. Ich legte mich also rasch neben meinen Kameraden auf den Fußboden ins Stroh und versuchte wieder zu schlafen. „Knapper, Knapper, Knapper“ ging es unter meinem Kopf. Bums! Schlug ich mit den Füßen ins Stroh. Alles ist still. Nach einer Weile ging es wieder los und so blieb es, bis es Tag wurde. Dann waren die Flöhe auch weg. Mit meinem Schlaf war das nun vorbei. Ich fing nun also meine Morgenroutine an und wollte versuchen, die verdammten Flöhe loszuwerden. Damit mich nicht wieder welche anspringen sollen, stieg ich mitten in der Stube auf eine Bank und fing an, diese Stück für Stück zu entfernen. Ganz ohne Lärm gingen ja die Vorbereitungen nicht ab. Die anderen Kameraden wachten auf und lagen nun noch im Stroh als dankbares Publikum um mich herum. Ganz vorsichtig machte ich meine Unterhose auf und siehe da, wie eine Fontäne sprangen mir gleich an die 20 Flöhe entgegen und fielen in das Stroh. Schließlich stand ich nun da wie Adam im Paradiesgarten und schüttelte die letzten Flöhe ab. Alleine das Wissen, die Flöhe nun los zu sein, war schön. Nachher mussten die anderen sich auch entflöhen.
[/read]
[read more=“Auf nach Galizien. (26. bis 30. September 1914)“ less=“Auf nach Galizien. (26. bis 30. September 1914)“]
Der nächste Tag, der 26. September, war Ruhetag. Morgens kochten wir uns einen schönen Kakao und zu Mittag überraschte uns Dickerchen mit schönen Gänsebraten. Schon gefüllt und richtig im Backofen gebraten. Dies übernahm uns so, das wir nachher im warmen Sonnenschein im schönen Graf einen Nachmittagsschlaf haben mussten. Hier in Gorne traf ich nach längerer Zeit auch wieder meinen Freund Klemann, der hier auch im Quartier lag. Wir bekamen nun auch zu wissen, dass wir nach Soldau zurücksollen, von wo wir verladen werden sollen. Dieser Tag war mit Flöhe angefangen und soll mit Leid aufhören. Berge juckte es abends am Hals so sehr, und war in seinem Leid wie ein kleines Tier, was keiner von uns kannte.
Am 27. September marschierten wir nach Bilowko ins Quartier und am 28. September über Mlawa-Illowo nach Narzym, auf deutschen Boden. Auf den ganzen Marschen hatten wir Sturm und Regen, um so angenehmer wurde es in Narzym, das zum größten Zeil abgebrannt war. Der Kompaniestab kam in das Haus von Brause ins Quartier. Es war so gemütlich und freundlich, dass es wie uns als wie bei uns Zuhause vorkam. Ich fuhr nachmittags mit einem Wagen nach Soldau herein und besorgte verschiedenes auf der Post. Ich brachte einen Wehrmann Schneider, der sich auf einem Marsch auf der löcherigen Landstraße ein Bein gebrochten hatte, ins Lazarett.
Am 29. September war bis nachmittags um 4 Uhr Ruhetag und dann marschierten wir bei Sturm und Regen nach Soldau. Um 6 Uhr kamen wir auf dem Bahnhof an, wo wir bald hörten, dass die Reise in die Richtung nach Oberschlesien gehen soll. Um 7 Uhr bestiegen wir den Zug. Nun ging also unsere Reise zu einem anderen Kriegsschauplatz. 2 Tage sollen wir fahren, soviel war schon durchgesickert. Wir glaubten alle, es ging nach Galizien. Ein Abteil hatte ich mit einem Feldwebel und wir richteten uns gemütlich für die lange Fahrt ein. Schultz brachte uns zwei große Schlafdecken aus dem Packwagen. Wir wickelten uns in diese ein, als der Zug um 7:15 aus Soldau abfuhr, und verbrachten so die Nacht ganz gut. Die einzigste Störung war nachts um 10:30, wo wir in Deutsch Eylau Kaffee bekamen.
Morgens um 5:30 am 30. September, kamen wir in Hohensalza an, wo wir in Baracken mit Kaffee, Semmel und Wurst verwöhnt wurden. Die Fahrt ging bald wieder über Gnesen – Wreschen – Jarotschin – Ostrowo – Kreuzburg – Beuthen – Myslowitz – Bendzyn – Czenstochau – Nowow Rademsk – Kaminsk. In Ostrowo war mittags rast mit Massenabfütterung. Auf allen Stationen wurden von den Vaterländischen Frauenverein und mit vom Roten Kreuz Wurst, Butterbrote, Kaffee, Tee, Äpfel, Zigarren und Zigaretten, in großen Mengen verteilt. Stellenweise gab es soviel, dass wir es gar nicht alles verbrauchen konnten. Hier sah man wirklich, wo all das Geld blieb, das im ganzen Land gesammelt wurde. An den Damen, die die Verteilung übernahmen, wurden große Anforderungen gestellt. Seit Wochen fuhren auf diesen Strecken andauernd Truppenzüge. Alle zwei Stunden fuhr ein Transport durch. Tag und Nacht waren diese Damen auf den Beinen. Jeder Transport wurde von ihnen freundlich aufgenommen und bewirtet. Meist ging das Verteilen ruhig und ordendlich, aber zwei Rebellen waren doch immer dabei, die nicht genug kriegen konnten und auch nicht mal „Danke schön“ sagten. Na, durch Freundlichkeit und Höflichkeit der Damen gegenüber, machten die anderen Leute das dann wieder gut. Das Wetter war nasskalt und nasskalt war auch die Stimmung von meinem Abteilsgenossen. Feldwebel Maestling, er war wohl trüber Ahnungen. Er schimpfe über die Österreicher, die wohl in Galizien ihren Kram nicht allein fertigmachen können. Dort waren ja, seitdem wieder dort Menschen waren, allerlei Nachrichten zu uns gelangt, die von großer Niederlader der Österreicher erzählten. Wir glaubten ja vorläufig auch immer noch, das wir direkt nach Galizien fahren. Das Hindenburg uns nun über von Seiten her gegen Warschau schicken wollte, ahnten wir nicht. Der olle Herr war ja in der Stimmung, seine Pläne ganz heimlich mit seinen Ludendorff zu planen, ohne es ja gleich an die große Glocke zu hängen. Ich versuchte mit verschiedenen Methoden die Laune von Maestling zu verbessern, aber er blieb dabei, dass dies seine letzte Reise war. Er fand es unerhört, das deutsche Truppen andere als deutsche Grenzen, schützen sollen. „Glauben sie mir“, sagte er, „wenn wir nach Galizien kommen, das wird unser Massengrab. Ich komme nicht wieder nach Hause“. Nach Galizien kamen wir vorerst nicht. Wenige Tage später wurde Maestling erschossen.
[/read]
[read more=“An der Spitze des Regiments. (1. Oktober 1914)“ less=“An der Spitze des Regiments. (1. Oktober 1914)“]
Mittlerweile wurde es Abend. Unser Wagen hatte noch keine eigene Beleuchtung, wir waren auf Kerzen angewiesen. Um diese zu sparen, saßen wir nun im Düsteren. Maestling ging seinen Gedanken nach, und ich sang allerhand Lieder. So kamen wir abends um 9 Uhr in Kreuzburg an. Hier bekamen wir zu wissen, dass unsere Reise nicht nach Galizien, sondern über Myliwitz gehesen soll. „Nanu“, sagte ich zu dem Schaffner, der uns dies erzählte. „Dann hätten wir doch über Kalisch fahren können?“ „Das geht nicht“, erzählte er uns. „Die Strecke ist ebenfalls seit 14 Tagen überlastet, auch dort fuhren andauernd Transporte“. Dort schin ja also eine ganze Armee hinzumarschieren. Nachts fuhren wir durch das oberschlesische Industriegebiet. Ringsherum glühten die Hochöfen und schossen ihre rote Glut mitten ins Land durch die Brennschächte, die alle zum Himmel ragten. Morgens um 6 Uhr am 1. Oktober waren wir in Bendzin und bald fuhren wir durch Lenstochau und bewunderten von weiten das berühmte Kloster, das ja noch vor gar nicht langer Zeit durch den Mord eines Mönches in aller Munde war. Das Kloster liegt malerisch auf einer Anhöhe bei der Stadt und ragt aus einem Kranz größerer Bäume hervor. Vormittags um 10 Uhr kamen wir in Nowo Radomsk an. Hier sahen wir auf dem Bahnhof allerlei militärisches Leben und merkten gleich, dass hier wohl was in Gang wäre. Nebenbei sah ich einen langen Zug mit einer Fliegerabteilung, die 8 große Flugzeuge mitführen ließ. Auf den Straßen und Chausseen fuhren endlose Proviant- und Munitionskolonnen entlang, Truppen aller Art passierten durch. Unser Bataillon wurde hier überhaupt nicht ausgeladen, sondern führte nach ewigen Aufenthalt noch bei Kaminsk, wo wir dann nach 40 stündiger Bahnfahrt ausgeladen wurden. Bei unserer Ankunft hörten wir ganz in der Ferne Kanonendonner. Nachmittags um 5 Uhr kamen wir in Kaminsk in das Quartier. Wir drei Zugführer kamen in ein Restaurant, wo wir ganz freundlich aufgenommen wurden. Die Leute brachten uns saubere Betten in die Stube und bewirteten uns auch anständig. Wir bekamen Polen auch vom anderen Ende zu sehen und saßen nun südwestlich von Warschau, die Gegend hier machte einen ganz anderen Eindruck, als oben im Norden. Das Land ist hier viel flacher und steht in besserer Kultur. Hier sind auch ab und an ordentliche Chausseen zu finden. Die Bevölkerung macht einen viel intelligenteren Eindruck, als die Bauern, die wir besser kennengelernt haben. Hier saß man doch auch mal wieder in Strumpf und Schuh.
Am 2. Oktober, morgens 7:00 marschierten wir aus Kaminsk wieder ab und kamen in Bujny in das Quartier. Bujny ist ein kleines Dorf an der Chaussee nach Petrikau. Wir 3 Zugführer richteten uns in einer Stube in einem Haus ein und hatten es hier ganz gut befunden, zumal wir frische Butter von unserem Wirt bekamen und uns Pellkartoffel dazu bringen lassen konnten. Ich gab an diesen Abend noch eine Vorstellung als Gedankenleser und nachdem sich die Geister wieder beruhigt haben, schliefen wir auf Stroh bis in den hellen Tag hinein.
Am 3. Oktober brachten wir um 9 Uhr von Bujna aus auf und kamen um 10 Uhr vor der Stadt Petrikau an. Wir freuten uns alle auf schöne Quartiere. Die Stadt war schon sehr belegt und wir blieben von 10 Uhr vormittags, bis 3 Uhr nachmittags vor der Stadt, bei den ersten Häusern, liegen. Ich hatte das Glück in einem Haus, dich bei unserem Lagerplatz, deutschsprechende Leute zu entdecken. Bereitwillig stellten sie mir ihre Küche zur Verfügung und so konnte ich unsere Stabsportion Schweineschinken schön braten. Wir sahen nun immer mehr andere Truppenteile vorbeimarschieren. In dieser Gegend befindet sich das 11., 22. 17. Und das Garde Reservisten Korps, außerdem eine Kavalleriedivision und noch 2 Reservisten Divisionen. Das Wetter, das am Tag vorher noch recht frisch war und mit viel Regenschauer unterbrochen war, besserte sich heute und wurde direkt schön. Nachmittags marschierte unser Regiment weiter. Unsere Kompanie war die vorderste und mein Zug marschierte voraus. Ich kam nun also an die Spitze des Regiments.
[/read]
[read more=“Ja, so ist der Krieg.“ less=“Ja, so ist der Krieg.“]
Der Marsch auf einer glatten Chaussee führte durch herrlichen Kieferwald und gestaltete sich zu einem herrlichen Spaziergang. Abends kam der Vollmond heraus und wir passierten die kleine Stadt Wolborg. Um 9 Uhr kamen wir im kleinen Dorf Chorzencyn an, wo unsere Kompanie als Vorposten das Quartier betrat. Die Unterbindung von uns Leuten war ziemlich schwierig, weil eine Schwadron sächsischer reitende Jäger hier einquartiert war. Da mein Zug nicht auf Feldwache brauchte, blieb ich auch im Dorf und zog mit dem Kompanieführer und Stab in eine Stube. Hier sah es aus wie in einem Saustall und da die Stubenfenster alle zugenagelt waren, stank es hier sehr. Der Besitzer selber war ein dreckiger Kerl, den wir aus seiner Stube herausgeschmissen haben. Mehrmals versuchte er wieder hereinzukommen, aber uns blieb das Brot im Hals stecken, wenn wir ihn bloß anschauen würden. Es wurde ihm also ganz schnell verboten, wieder hereinzukommen und so musste er sich es nun in der Scheune bequem machen. Im Dorf wurden 3 Schweine requiriert, die gleich geschlachtet werden würden. Mit den Requisitionsscheinen wollten die Bewohner Geld haben. Der Kompanieführer sagte, dass sie morgen aufpassen sollen, wenn der Zahlmeister mit dem großen Geldbeutel hier durchkam. 2 von den Männern ließen sich überzeugen, aber der dritte war hartnäckiger. Er brabbelt und quält immer zu und traute dem Schein nicht. „Aber mein lieber Mann“, sagte der Oberleutnant. „Herr Zahlmeister morgen an Acker von Straße“, aber all das half nicht. „Na dann werde ich das aus meiner Tasche bezahlen, damit der Kerl ruhig ist und wir endlich weiter essen können“, sagte ich, langte ins Portemonnaie und holte einen Geldschein heraus. „Aber um Himmelswillen Klingenberg, Sie werden doch nicht Ihr Geld nehmen!?“, sagte der Oberleutnant ganz verblüfft. „Ja“, sagte ich. „Edel sei der Mensch, Hilfreich und gut! Das kommt mir da gar nicht darauf an.“ und dabei langte ich dem Herrn den Schein her, der mit tiefen Dank die Hand aufmachte und rückwärts in der Stube verschwand. „Aber Klingenberg, wie konnten sie bloß?“, sagte der Kompanieführer noch ganz benommen von meinem Opfermut. „Ach“, sagte ich, „ganz ruhig und aß weiter. „Das war ja nur ein Umschlag von einem Heftpflaster, richtiges Geld was das nicht. Na, dann ging ja das Lachen los, obgleich das ja eigentlich recht traurig war, dass wir den armen Kerl so angelogen haben. Aber er hatte ja seinen richtigen Requisitionsschein auch behalten und war nun darüber glücklich. Ja, so ist der Krieg! Nachdem die Stube nun ordentlich ausgemistet wurde, wurde Stroh hereingetragen und wir lagen uns auf dem Fußboden zum Schlafen hin. An das einzige Bett, das in der Stube stand, traute sich keiner heran, wegen der unbeliebten Flöhe Jagd. Dieses Bett machte uns überhaupt so einen verdächtigen Eindruck, denn es war immer rundum dicht mit Bretter zugestellt. Bei dem trüben Schein, von einer Lampe die mitten in der Stube hing, schliefen wir endlich ein. Wir mussten wohl schnell eingeschlafen sein, dann fing es neben uns an zu gackern. Einer von uns ist wohl gegen die Bretter gekommen und mit einmal ging eine Gruppe Hühner in der Stube umher. Dickerchen scheucht die Biester hin und her und jagt sie aus der Stubentür heraus. Ein Huhn ist immer noch in der Luft und landet auf uns. Wir zogen die Decken über unsere Köpfe, während Dickerchen vergeblich Jagd auf das letzte Huhn machte. Mit einmal machte es „Klirr!“ und das Huhn flog in seine Angst durch die Fensterscheibe nach draußen. Nun trat ein kühler Lufthauch über uns und schwupp ging die Lampe aus. Kaum hatten wir uns wieder beruhigt, dann tauchte der Oberleutnant auf. „Zum Donnerwetter, wer trampelt mir auf dem Bauch!“ Nun war dann endgültig Ruhe.
[/read]
[read more=“Balancierend über den Fluss. (4. bis 7. Oktober 1914)“ less=“Balancierend über den Fluss. (4. bis 7. Oktober 1914)“]
Am 4. Oktober, ein Sonntag, morgens um 9.30 verließen wir diese gastliche Stätte. Unser Marsch führte uns durch die kleine Nette Stadt Tomaszow, die einen ganz sauberen Eindruck machte. Die Stadt hatte hübsche Kirchen, von den mir die eine mit goldenen Kreuzen gekrönte Kuppel besonders auffiel. Um 12:30 mittags kamen wir in das für unser Quartier bestimmtes Dorf Bialobrzegi an. Der ganze Kompaniestab zog in das Haus von dem Ortsvorsteher. Der gute Mann war mit seiner Familie ausgezogen, hatte aber die Wohnung tadellos eingerichtet zurückgelassen. Hier stand auch ein vorzügliches Grammophon und nun hatten wir nach wochenlanger Pause mal wieder Musik. Ich tanzte mit Berge nach dem Klang von einem schönen Walzer in der Stube herum. In Tomaszow haben wir Zugführer uns jeder eine Flasche Rotspon gekauft, den wir nun auf das Wohl von uns lieben zu Haus austranken. Dazu aßen wir eine Büchse Sardinen, die ich den Tag vorher mit der Post bekam. Wir kamen uns wie Feinschmecker vor. Um 6 Uhr ging es zum Diner, denn Dickerchen hatte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in der Küche ein schönes Filet zu braten. Nach Tomaszow schickten wir ein Fahrzeug herein und ließen uns noch ein kleines Fass Bier holen und so wurde das auch noch ein feiner Abend. Das einzige, der nicht in der Stimmung war, war Feldwebel Maestling der hier zum ersten Mal richtige Lohnungslisten für die ganze Zeit schrieb, weil der Kompanieführer diese nun verlangte. Hier kann man sehen, wie harmlos zuerst Wirtschaft wurde. Das ganze Inventar von dem Feldwebel, sein Schreibstück, war sein Vorzeigebuch. Während wir bei Bier viel sangen, umfängt uns aus der Küche der liebliche Duft von frischeren Grieben, den Dickerchen gekocht hatte, damit wir mal was zu essen haben. Bei den täglichen Märschen bekamen wir immer guten Appetit. Manch einer von uns Leuten hielt freilich nicht durch, und ab und an sah man zur Rechten, wie auch zur Linken einen strammen Landwehrmann niedersinken. Meist kamen sie dann doch noch mit zwei Stunden Verspätung in das nächste Quartier an, einige aber auch in ein Lazarett. Ich persönlich hatte keine Schwierigkeiten beim Marschieren. Meinen Speckbauch war ich allmählich losgeworden und mir wurde das Laufen nun leicher, als jemals in meiner aktiven, Reserve- und Landwehrdienstzeit.
Am 5. Oktober früh um 6:30 Uhr rückten wir weiter und marschierten zunächst zum linken Ufer von der Pilica, einen Nebenfluss von der Weichsel, entlang. Über das Flusstal hatten wir den malerischen Anblick von der Stadt Tomaszow, vor uns erstreckten sich große Wäldungen. Bald kamen wir in den Wald und erreichten auch die tadellose Chaussee des kaiserlichen Jagdschlosses Spala, das hier inmitten herrlicher, riesiger Buchen liegt. Das Schloss an und für sich ist ein kleines und sehr einfach gehalten. Über großen Umfang waren aber die Wirtschaftsanlagen, die einen großen Komplex einnahmen. Wir hatten hier Rast gemacht, da das Betreten des ganzen Anwesens verboten war. Uns war nun die höhere Kavallerie Kdr. Frommel unterstellt und marschierte auf den linken Flügel von der Armee, die sich von südosten auf Warschau bewegte. Als die Brücke vor uns von unser Pionie durch einen kleinen Steg ersetzt wurde, überschritten wir einzeln balancierend den Fluss und bedauerten es sehr, das wir schließlich wieder aus den prächtigen Wald herauskamen. Wir gerieten nun auf einen ganz fürchterlich tiefen Sandweg (die Chaussee war bloß bis zum Jagdschloss gegangen), und kamen über Krolowa Wola zu dem Dorf Reszirau, wo wir mittags um 1 Uhr Rast auf den Acker machten. Unsere Lebensmittelvorräte waren nicht mitgekommen und nun mussten die Mannschaften sich Kartoffel buddeln und selber abkochen, damit sie doch wenigstens etwas zu essen hatten. Ich bekam im Dorf 10 Eier und ein bisschen Butter und Milch und machte Rühreier, wozu ich den Kompanieführer und die Zugführer einlud. Der Aufenhtlat auf dem Acker war nicht angenehm. Als wir Meldung von der ständig vor uns aufklärende Kavallerie bekamen, wurde um 14:45 wieder angetreten. Der Marsch durch den tiefen Sand scheinte uns endlos. Autos, die mit höheren Offiziere an uns vorbei wollen, buddelten sich fest und waren nicht vorwärts zu bekommen. Es wurde dunkel, der Mond kam auf, aber noch immer war unser Ziel nicht in Sicht. Endlich, abends um 20:30 kamen wir in die kleine Stadt Nowo Miasto an, wo wir in den Straßen in tiefen Dreck bis an die Enkel versackten. 42 Kilometer waren wir gegangen und der folgende Ruhetag, den 6. Oktober, war ehrlich verdient. Der ganze Kompaniestab lag bei einem blinden Organisten in Quartier. Es war richtiges Sauwetter. Die Bevölkerung wurde beauftragt, auf dem Markt einen Platz von den tiefen Morast zu säubern, damit wir doch mal ein kleines Appell halten können. Wir pflegten uns nun so gut als es ging mit Rotwein, Bier, Koteletts und Eier, für die Strapazen, weil wir ja am nächsten Tag wieder weitersollen. In der Nacht kam unerwartet der Befehl wieder zu rasten.
Auch der 7. Oktober soll für uns noch Ruhetag sein. Dies hatte seinen Grund darin, dass die rechts neben uns marschierenden Heere eine große Schwenkung nach links ausführen mussten. Dies war jedenfalls wohl der Zeitpunkt, wo sich überraschend nördlich von uns, von der Festung Nowo Georgiewsk her große russische Streitkräfte entwickelten, die unsere Flanke umfassen soll. Hierdruch wurde auch der ursprüngliche Plan unserer Heeresleitung vereitelt und in den Gefechten von dem nächsten Tag führte dies ja auch zu unserem Rückzug von Warschau. Vorläufig ahnten wir dies ja überhaupt noch nicht. Unser Oberst sagte allen, dass wir in Warschau unseren Einzug holen würden und verordnete, dass die Leute ihre Backenbärte abrasieren sollen, damit sie jünger aussehen.
[/read]
[read more=“Auf zum Sturmangriff. (8. bis 10. Oktober 1914)“ less=“Auf zum Sturmangriff. (8. bis 10. Oktober 1914)“]
Am 8. Oktober wurde der Vormarsch in nordöstlicher Rochtung fortgesetzt. Über Magielnica an der Mogielanka erreichten wir die Kolonie Glowcyn, wo unsere Kompanie in Vorpostenstellung kam. Der Marsch hierher war recht interessant, da wir verschiedene kleine Waldstücke in in Schützenlinie durchsuchten, weil wir jetzt darauf gefasst sein mussten, mit dem Feind in Kontakt zu treten, welcher 18 km vor uns feste Stellung halten soll.
Die Nacht blieb ruhig und am 9. Oktober wurde in Nordwestlicher Richtung über Popowice – Chodnow zu der kleinen Stadt Biala marschiert, wo wir nachmittags um 16 Uhr ankamen. Nun wurde die Sache wieder lebhahfter. Abends hörten wir aus der Richtung von Mogielnica Kanonendonner und sahen großen Feuerschein. Nun würde es ja auch für uns bald Arbeit geben.
Früh morgens am 10. Oktober marschieten wir aus Biala ab. Unser Regiment marschierte, rechts von uns war die Schlacht anscheinend schon in vollen Gang. Vom frühen Morgengrauen an hörten wir rechts vorwärts von uns fürchterlichen Kanonendonner. Wir marschierten ohne Aufenthalt, unser Bataillon hatte die Spitze. Das Kanonendonner rechts von uns marschierte mit, offenbar machen unsere Truppen Fortschritte. Nachmittags, als wir gerade das Gehöft Jkuly passiert hatten, kam plötzlich einer von unseren Fliegern in schneidigen Flug und landete 2 Meter neben unserer Marschkolonne, bei der sich grad der Stab Frommel befand. Unsere Artillerie wurde plötzlich vorgerrückt und führte links vorwärts an unseren Weg vorbei. Das Vorbeigehen auf der engen Straße führte ein Geschütz von unserern M. 9 Fahrzeugen an, so dass ein Schütze vom Wagen fiel und starb. Während die ganze Division halt machte, musste unser Bataillon sich zunächst rechts von der Straße entwickeln. In erster Linie 6. und 7. Kompanie. Gestaffelt dahinter war die 5. und 8. Kompanie. Rechts neben uns wurde das 3. Bataillon eingesetzt. Vor uns lagen die beiden zusammenhängenden Dörfer Zelechow und Orsnanow. Wie es hieß, sollen feindliche Truppen mit Infanteriebedeckung dort sein. Hinter den Dörfern erstrecke sich, so wie man es sehen konnte, dichter Wald. Zwischen uns und das Dorf war ein weiter Wiesengrund, durch den wir durchmussten. Unsere Artillerie nahm nun das Dorf und den Waldrand unter Feuer und schoss mit Schrapnellen. Unser 1. Zug unter Klemann ging nun zum Angriff vor und ich folgte dem 2. Zug. Der Feind hatte sich in Hecken und Häusern eingenistet, doch als unsere Artillerie dort hereinschossen, sahen wir, wie die Kerle austraten. Als wir ungefähr 600 Meter an das Dorf herankamen, waren wir mit einmal mit Feuer förmlich überschüttet. Zum Überfluss auch noch Flankenfeuer von einer Höhe, rechts von uns vor dem Wald. Wir lagen nun preislich mitten in der kahlen Wiese. Zurück konnten wir nicht, liegenbleiben auch nicht. Das Feuer pfeift und zischt über uns weg, das uns hören und sehen verging. Schießen konnten wir nicht, weil der erste Zug dicht vor uns lag. Wir duckten also unsere Köpfe in den freuchten Grund, so gut wie es ging. Unsere Artillerie feuerte nicht mehr, weil wir alle zu dicht am Dorf waren. Plötzlich kam auf einmal das Signal „Seitengewehr zur Seite, es wird nicht mehr geschossen!“. Bald hieß es dann „Tata tata Tata tata (Hornsignal)“ zum Sturmangriff. Mit verschiedenen Sprüngen ging es nun durch den Kugelregen vorwärts. Der erste Zug geriet in der Lage etwas nach Links uns so kam ich mit meinem Zug auch in die erste Linie. Etwa 400 Meter vor dem Dorfrand, als ich nach einem Sprung gerade im hinlergen bin, drückte mir etwas durch die linke Schulte, als wenn mich einer mit einem Knüppel zusammenschlug. Das war so ein kurzer, schmetternder Schlag. „Verdammte Bande“ rief ich bloß! Abermals tönt das Signal zum Vorgehen und ich ging mit geschwungenem Säbel, mit Begleitung von meinem Entfernungsschätzer Schaper, mein Zug mit voran. Hinliegen erfolgt bloß noch zum Atemholen. Breite Gräben, die die sumpfige Wiese durchstrecken, hinderten unseren Weg. Über diese Gräben geht es nur mit einem Sprung. Ein Graben ist mir zu breit und plötzlich sitze ich bis über die Knie im Wasser. Rechts und links von mir bald dasselbe Bild. Wieder aufgeräppelt und weiter vorwärts.
[/read]
[read more=“Ruhe in Frieden, Kamerad.“ less=“Ruhe in Frieden, Kamerad.“]
Als erster von meinem Zug erreichte ich mit 3 Mann den Dorfrand. Diesen Sturmangriff hielt der Russe nicht stand. Er flüchtete. Bloß Verwundete fielen uns in die Hände. Wir drangen in das Dorf ein und fingen an die Häuser abzusuchen. Verschlossene Türen wurden mit der Axt aufgeschlagen, Fenster, wenn nötig eingeschlagen. Wir machten allerhand Gefangene, diese gehörten zu sibirischen Regimenter. Ich nahm einem Kerl die Mütze weg, die ich als Andenken mit nach Hause gebracht hatte und als Trophäe aufbewahrte. Nebenbei erbeutete ich auch noch 2 Motorräder. Inzwischen fing es an schon dunkel zu werden und ich sammelte mein Zeug und blieb bei der nachgekommenden Gruppe, hinter der Wiese von einem Gutshaus liegen, wo sich schließlich auch Berge mit dem 3. Zug anfindete. Über uns schlugen verschiedene Kugel ein, da jenseits vom Dorf das Gefecht noch nicht vorbei war. Schließlich bekamen wir Befehl, das unser Bataillon sich bei der Kirche sammeln soll. Wir rückten also dorthin ab und gingen mit dem Rest von unserer Kompanie dahin. Unser Oberleutnant und Klemann waren gesund geblieben, aber unser Feldwebel Maestling und Tambour Krengel waren gefallen. So hatte die Ahnung von Maestling doch gestimmt und er musste so früh ins Gras beißen. Ruhe in Frieden, Kamerad. Zunächst nahmen wir nun hinter hinter dem Kirchhof die Verteitigungsstellung ein, aber bald bekam das Bataillon den Auftrag, in dem Wald auf Vorposten zu treten. Mittlerweile brannte es mir an an der Schulter und ich dachte an meine Verwundung. Richtige Schmerzen hatte ich aber nicht, auch konnte ich meinen Arm bewegen. Am liebsten wäre ich bei der Kompanie geblieben, aber der Oberleutnant und Klemann rieten mir zu, zu dem Verbandsplatz zu gehen. Ich verabschiedete mich nun bei all meinen Kameraden in der Hoffnung, am anderen Tag nachzukommen. Meine Kompanie ging auf Vorposten dund ich suchte unsere Verbandsstellung, die im Pfarrhaus untergebracht war.
Ach, wie traurig sah es hier aus! Fast alle Stuben waren schon überrannt und lagen voller Verwundeter. Ich selber half so viel mit, wie ich mit meinem unbeschädigten Arm machen konnte. Es waren ja so viele, denen es noch schlimmer als mir ging.
Die Ärzte, allen voran unser Stabsarzt Weigelt, hatten alle Hände voll zu tun und man sah allen an, wie angespannt sie waren. Dort lagen nun die Kameraden reihenweise auf dem Boden, im Stroh. Die Schmerzen ware groß, aber das war nicht das schlimmste. Sie stöhnten voller Schmerz, aber alle waren doch ruhig und gefasst und keiner klagte. Alle waren sich bewusst, dass sie ihre Pflicht getan haben. Ja, da war noch ein guter Geist in den Leuten und sie wussten, dass sie für das Wohlergehen von dem Vaterland und das deutsche Volk leiden mussten. Eigennütz war denen nicht im Sinn. Nachdem ich wieder rein in das Haus ging, ging ich in die hinteren Stuben, wo es noch trauriger aussah. Dort lagen die Schwerverwundeten mit Brust und Bauchschüssen. Dort lag so mancher Todeskandidat, die langsam starben, weil keine Hilfe nützte. Bei kleinem Petroleumlicht und Tageslicht wurde dort eine Menge herumhantiert. Gegen 11 Uhr wurde ich als letzter vom Stabsarzt Weigelt selbst verbunden und er sagte, er wollte es auch recht gut machen, weil er es meinen Eltern in Stralsund versprochen hatte. Er war nämlich noch in den letzten Tagen vor unserer Ausreise bei uns im Geschäft. Der Einschuss saß bei mir in der linken Schulter über das Schlüsselbein und der Ausschuss etwa 10-12 mm weiter im Rücken. Die Knochen waren glücklicherweise nicht verletzt. Gegen 12 legten wir uns dahin, wo noch Platz war, neben den Verwundeten.Wir schliefen bald ein, das Geröchel und Gestöhne neben uns war groß. Am 11. Oktober morgens kam der Befehl, dass die Sanitätswagen unser Bataillon nachkommen soll. Ich wollte nun auch mit, aber das wollte der Stabsarzt nicht. „Alle Verwundeten bleiben hier und selbstredend auch Sie“, sagte er. „Im Laufe des Vormittags kommt hier die Sanitätskompanie durch. Sie übernehmen hier die Aufsicht und übergeben dann die Kranken“. Na, das ließ ich mir nicht zweimal sagen.
[/read]
[read more=“Zusammenhalt unter uns.“ less=“Zusammenhalt unter uns.“]
Als ich morgens zuerst aus der Haustür herausging, fiel mein Auge auf einen Toten, der neben den Eingang lag. Er hatte wohl einen Kopfschuss bekommen und die ganze Schädeldecke war abgesprungen und das Gehirn kam aus dem Kopf heraus. Der ganze Schädel war hohl, wie ein Pokal. Im Dorf war es nun ruhig geworden, da das Gefecht nun jenseits des Dorfes fortgesetzt wurde und alle Truppen abgerückt waren. Nach und nach kamen die Einwohner, die sich am Tag vorher bei dem Gefecht versteckt hatten, wieder zum Vorschein. Bei uns im Pfarrhaus waren zwei junge Mädchen, Tochter von dem Gutsverwalter, die hatten die ganze Nacht tüchtig mitgeholfen und unsere Verwundeten gepflegt. Wo ihr Vater geblieben war, wussten sie nicht. Ich war nun hinter dem Haus in den Garten gegangen, da sah ich einen Mann durch das Gebüsch, in das Haus hineingehen. Im selben Augenblick hörte ich hinter mir einen Schrei und aus der Tür flog der Mann von einem der jungen Mädchen entgegen. Das war ihr vermisster Vater.
Diesen Schrei vergesse ich in meinem Leben nicht und den Schrei höre ich immer noch in den Ohren. Was alles an Gefühl in diesem Schrei war, das lässt sich nicht beschreiben. Auch wenn 10 Pastoren predigen nach allen Regeln der Kunst, so ging einem das nicht so ans Herz, als so ein Erlebnis.
Gegen 10 Uhr vormittags kam die Sanitätskompanie an und ich übergab den Arzt meine Verwundeten. Die Leichtverwundeten wurden aussortiert und wurden in einem benachbarten Haus untergebracht. Ich hatte von den Sanitätssoldaten eigentlich nie viel gehalten, denn sie revidierten alle die fremden Tornister von den Verwundeten und Gefallenen. Aber das mag auch wohl zum Teil ein Vorurteil von mir sein, alle waren wohl nicht so. Jedenfalls lernte ich einen Sanitätssoldaten kennen, der uns zur Seite gestellt wurde. Er war ein freundlicher, unneigennütziger Kamerad geworden. Er hieß Woyke und was aus Kamin bei Goslarshausen in Westpreußen. Ich hatte ihm nach Jahre wieder getroffen, als er auch in rührender Weise andere Verwundete betreute und gedenke daher hier seiner. Zu gleicher Zeit mit der Sanitätskompanie war auch unser Gepäck angekommen und bald kamen die Kameraden, um mich zu besuchen und nun ihre Teilnahme auszudrücken. Das war direkt rührend. Alle wollen, dass es mir wieder gut geht. Der eine brachte Wurst und Speck, jemand anderes Brot. Dort kamen Leute, die ich gar nicht besonders kannte und brachten Eier, Zigaretten, Äpfel usw. Alle freuen sich, dass es nicht so schlimm war. Ich erzähle das hier bloß, um zu beweisen, was doch für ein Zusammenhalt unter uns war. Leider lag mein Tornister, wo ich allerhand drin hatte, auf dem Patronenwagen, welcher bei der Truppe war. Jedoch konnte ich meinen Kleidersack, der auf dem Gepäckwagen war, an mich nehmen. Währenddessen ging die Schlacht von früh bis spät jenseits des Waldes weiter und der Kanonendonner rollte weiter. Wir sahen die Schrapnelle über den Wald platzen. Gegen Abend kam der Befehl, dass das Gepäck zurückgeführt werden sollen. Zwischen unseren vordringenden Truppen soll eine Lücke entstanden sein und der Wald vor uns soll unsicher sein. Auch die Sanitätskompanie soll abrücken. Die Leichtverwundeten bekamen nun den Befehl, 2 ½ Kilomenter zurück zu marschieren. Ich schlief die Nacht mit Groverath und Zahlmeister Lembke zusammen in Kalin. Die Sanitätskompanie war aber nicht nachgekommen, die Lage hatte sich wieder verändert und so wanderte ich am anderen Morgen (den 12. Oktober) mit meinen Leichtverwundeten wieder weiter. Hier war inzwischen das Feldlazarett 11 eingetroffen, welche wir nun überwiesen wurden. Da sich über 75 Patienten zusammengefunden hatten, wurde das Lazerett ohne Befehl hier eingerichtet. Unser Gepäck und die Kolonnen bekamen den Befehl wieder vorzurücken, offenbar machten unsere Truppen Fortschritte auf Warschau. Jedoch auch das Lazarett musste wieder abrücken und 12 Kilometer vorrücken. Da haben wir den Salat. Alle Verwundeten mussten hierbleiben. Bei uns blieb bloß 1 Arzt, 1 Inspektor, 1 Unteroffizier und 2 Pfleger. Ich hatte mein Bett in einem Haus in einem kleinen Raum 3 Treppen hoch unter einem Dach. Bei mir schliefen noch Vizefeldwebel Timm und Unteroffizier Bork von der 6. Kompanie. Es war kalt, wir heizten den kleinen Herd mit zwei Kohlestücken. Der Raum hatte bloß ein kleines Fenster, das aber zwei Meter hoch angebracht war. Wir konnten nicht herausschauen. Dort war wohl nichts zu sehen. Ein bisschen regnet es und der ganze Himmel war grau. Bald wurde es schummerig. Da wir bloß eine kleine Lampe hatten, legten wir uns alle um 19:00 in das Stroh und schliefen ein.
[/read]

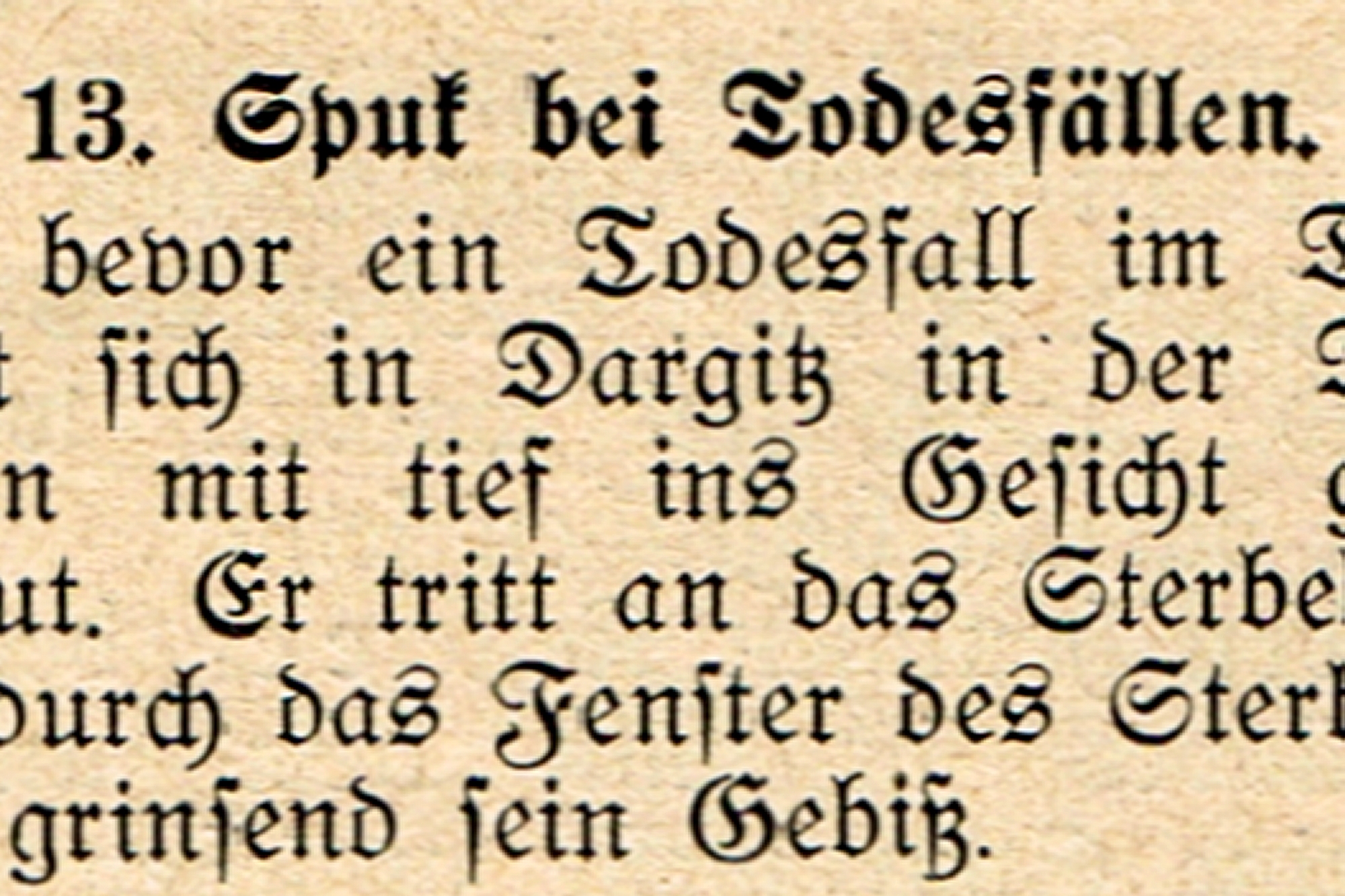

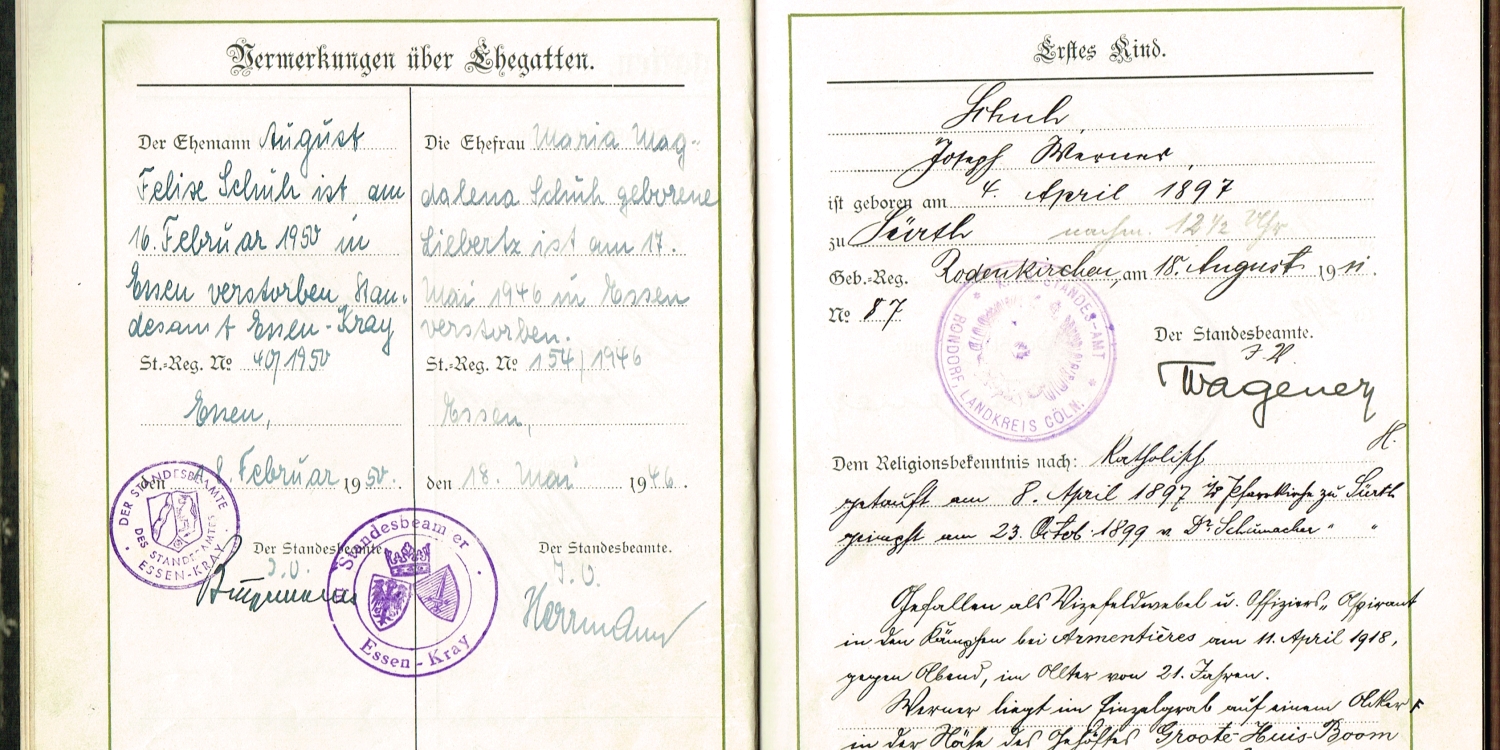
Hinterlasse jetzt einen Kommentar